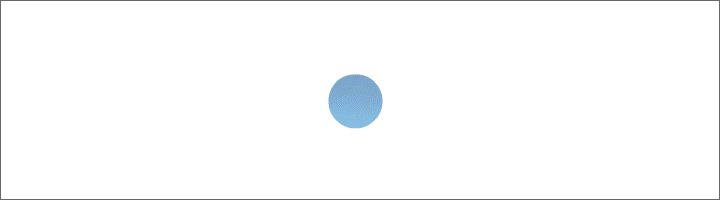Familiengeschichte meines Mannes
+ Bilder
Regierungsrat und Justizkommissarius
geboren 18. Juni 1775 in Magdeburg
gestorben 7. Oktober 1856 in Frankfurt/Oder
(geschrieben 1831)
Pommern und der Neumark Leute unseres Namens angetroffen habe, so hat sich doch meist
gefunden, daß ihre Voreltern Magdeburger waren. Die Weltmannsche Geschichte Magdeburgs,
ein lesenswertes und unterrichtetes Buch, gedenkt schon eines unseres Namens, der im 15.
Jahrhundert in Magdeburg gelebt hat. Um 1470 war auch ein Schartow Probst des Klosters
Unserer lieben Frauen zu Magdeburg.
Der Vater meines Großvaters, ein Johann Benedict, war Doktor juris und consul dirigens, oder,
wie man sich in Magdeburg auszudrücken pflegte, regierender Bürgermeister. Er hat mehrere
juristische Bücher verfaßt, welche, wo nicht den tiefen Denker, doch wenigstens den sorgsamen
und mit gehöriger Kritik sammelnden und zusammenstellenden Kompilator beurkunden. Er starb
im Anfang des vorigen Jahrhunderts und war ein Sohn eines H. von Schartow. Dies habe ich in
seiner kleinen, eher pomphaften im Geist damaliger Zeit verfaßten Postulatiae vorgefaßten
Biographie selbst gelesen. Warum er nicht auch Edelmann war, darüber ist mir keine
Überlieferung geworden. Sollte er ein Kind der Liebe gewesen sein, auf das der Stand des Vaters
nicht übergeht? Die Familie von Schartow, deren Existenz ich nicht bezweifeln kann, ist übrigens
längst ausgestorben. In Verbindung mit ihr steht das Dorf Schartau bei Magdeburg. In der Kirche
liegen mehrere alte von Schartow begraben, und die Altardecke soll noch in meiner Jugend das
Wappen der von Schartow gehabt haben, einen Pelikan, der nach fabelhafter, alter Angabe aus
eigenem Blute aus seiner Brust seine Jungen tränkt. Auch wir führen dieses Wappen noch jetzt.
Ich habe nie Gelegenheit gehabt, über das Verhältnis und über die ausgestorbene Familie und
ihre Verbindung mit jenem längst dem Staube gehörigen Dorfe nähere Erkundigungen
einzuziehen. Etwas Urkundliches mag sich auch kaum in Magdeburg ermitteln lassen, da alle
Archive, die das Herzogtum und die Stadt betreffen, bei der Zerstörung im dreißigjährigen Krieg
untergegangen sind. Unsere Familie muß übrigens slawischen, nicht keltischen Ursprungs sein.
Das zeigt der Name. Das Wort Schartow hat eine slawische Endung, es müßte polnisch
geschrieben werden Szartow; daß es etwas im Polnischen bedeute, finde ich in keinem
Wörterbuch. "Cart" heißt im Polnischen der böse Geist (Teufel). Wieviele Söhne oder Töchter
mein Eltervater, der Bürgermeister Schartow gehabt hat, ist nicht zu meiner Kenntnis gekommen;
ich weiß nur, daß einer seiner Söhne, meine Großvater Johann Benedict, für den Handelsstand
bestimmt, in einem großen Hamburger Hause die Handlung erlernte, sich dann in Magdeburg
etablierte und am Breitenwege eine sogenannte Brandstelle kaufte und sie bebaute. Das Haus
hatte zum Goldnen Hirsche schon vor dem Brand geheißen, und es behielt dieses Emblem bei.
Dieses Haus, das er - ich glaube 1724 erbaute - ist noch heut in unserer Familie, es fiel durch
Erbgangsrecht auf meinen Vater, und nach dessen Tode bekam es mein Bruder, der es noch
heute besitzt. Mein Vater ist in diesem Hause geboren, ebenso ich und meine Geschwister. Im
Jahre 1810 oder 1811, als Magdeburg unter Westfälischer Regierung den Lasten und Abgaben
fast erlag, mit denen das Grundeigentum damals beschwert wurde, fand sich mein Bruder
veranlaßt, den Goldenen Hirsch zu verkaufen. Nach wieder eingetretener Preußischer
Besitznahme 1814 brachte er aber das väterliche Haus durch Rückkauf wieder an sich.
Mein Großvater hatte sich 1724 mit Anna Dorothea Köppen, der Tochter eines Ratsherren in
Magdeburg verlobt, und am 19. April 1725 war ihre Hochzeit. In seiner Ehe wurden neun Kinder
erzeugt, fünf Söhne und vier Töchter. Fünf dieser Kinder verstarben in der Kindheit. Vier
erreichten ein bedeutendes Alter.
Der älteste, 1726 geborene Sohn Christian ward Kaufmann. Er hatte eine Rumpf zur Frau, eine
Großtante des jetzigen Ministers Klewitz, er starb schon vor meiner Geburt. Er war Holzhändler,
hatte wechselnde Schicksale, hinterließ wenig Vermögen und 3 Kinder. Einen Sohn, Christian, der
in Magdeburg die Handlung erlernte, gegen der Eltern und des Großvaters Willen 1774 nach
Ostindien ging und dort bald seinen Tod fand. Das Schiff, auf dem er die Reise von Batavia nach
Makao machte, ging unter. Außer diesem Christian Schartow verblieben 2 Töchter. Die älteste
war verheiratet an den Bankdirektor Kuntzel zu Magdeburg, einen fröhlichen und zuverlässigen
Mann, der den Verstand hatte, ungefähr 100.000 Taler zu erwerben und zu hinterlassen. Ich habe
mir schon in meiner frühesten Jugend die Handlungsweise dieses Mannes in mehrfacher
Beziehung zum Vorbild genommen, ich hatte Ursache dazu. Seine Umsicht in allen Geschäften,
seine Ruhe, mit der er alles zu überlegen, die Klarheit, mit der er seine Ansicht vorzutragen, die
Gründe, mit denen er sie geltend zu machen wußte, eine mehr als gewöhnliche Ordnungsliebe,
große Berufstreue, an der allerdings wohl Liebe zum Gewinn Anteil hatte, Ausdauer in
Geschäften, stete Regelmäßigkeit im Leben, besonders Enthaltsamkeit im Essen und Trinken
zeichneten diesen Mann in der Familie aus. Man kritisierte mitunter seine oft zu weit getriebene
Winklichkeit, indessen habe ich nicht finden können, daß er geizig gewesen wäre, wo der Anstand
es nicht zugelassen hätte. Unverkennbar hatte er ein gewisses Übergewicht in der Familie. Auf
mich und meinen Bruder hielt er sehr viel, das lag gewiß mit darin, daß er uns für gute Wirte hielt,
denn Verschwendung war ihm ungemein zuwider; und wo er Gesinnungen und eine
Handlungsweise fand, die den seinigen entsprachen, faßte er Zutrauen. Er war daher unser
Freund bis an sein Ende; ich bleibe gern vor dem Bilde dieses Mannes stehen, der auf meine
Bildung, mehr noch auf meinen Sinn Einfluß gehabt hat; nicht durch Lehre und Ermahnung, denn
er ist wohl nie in den Fall gekommen, mir irgendeine Ermahnung zu geben. Er besaß eine feste
Gesundheit, hatte ziemlich meine Constitution, jedoch nicht ganz meine Größe, war nie krank und
starb im Oktober 1814, 75 Jahre alt. Eine schwache Seite von ihm war unstreitig seine Vorliebe
für das Geld. Er hatte es erworben, sein Genuß dabei lag in dem Bewußtsein, zu erwerben und
erworben zu haben, in dem Besitze, nicht in dem Gebrauche. Seine persönlichen Bedürfnisse
waren beschränkt und gemessen. Ein Reitpferd war sein einziger für sein Vergnügen bestimmter
Aufwand. Die Haltung einer Equipage war, seit ich denken konnte, Gegenstand der Diskussion
unter den Eheleuten. Seine Frau konnte den schulichen Wunsch, mit eignen Pferden zu fahren,
nicht durchsetzen. Daß er als vermögender Mann starb, lag in seiner Sparsamkeit, denn er
erwarb nur durch das Aufsammeln seiner allerdings bedeutenden Einkünfte. Auf kaufmännischen
Erwerb konnte er nicht rechnen, handeln (Handel treiben) durfte er als Bankbeamter nicht. In
seinem Wesen finde ich den Satz bestätigt, der sich mir im Laufe meines Lebens oft dargestellt
hat, daß der Erwerbende in der Familie selten der Genießende ist. Der alte Kuntzel hinterließ eine
Witwe, meine Cousine, und 3 Kinder. Die Cousine ist vor ungefähr 10 Jahren gestorben. Der Tod
des Mannes und Vaters, so sehr er sie betrübte, erweckte doch die Neigung zum Lebensgenuß;
die Sparsamkeit des Hausvaters hatte manche Entsagung geboten, die Gefügigkeit der Familie
sie gebilligt, um dem alternden Herrn gefällig zu sein, aber nicht im Herzen, denn Mutter und
Kinder liebten Genuß jeglicher Art. Seit mehr denn 10 Jahren war die Tochter vom Hause in Berlin
an den jetzigen Geheimen Hofrat Behrend verheiratet, dahin strebte der Mutter und der beiden
Söhne Sinn, man zog nach Berlin, und die längst ersehnte Equipage wurde sogleich angeschafft.
Die Söhne waren von 22 und 19 Jahren. Der ältere hatte die Landwirtschaft erlernt, sein
Bestreben war der Ankauf eines bedeutenden Landgutes. Um meinen Rat deshalb zu hören,
besuchte er mich in Soldin; ich riet, in einer öffentlichen Lizitation zu kaufen, wo man damals am
wohlfeilsten kaufte. Er befolgte meinen Rat nicht, sondern kaufte das Gut Altheiden in der
Neumark von den Besitzern. Er hatte es viel zu teuer erstanden, eine Menge Geld darin verbaut,
und so erreichte ihn dann bald das Schicksal, und es kam zur Subhastation. Dieser Sohn Wilhelm
hatte sich mit der Tochter des Forstmeisters Olberg verheiratet, mit der er aber in Unfrieden lebte.
Sie trennte sich von ihm zu der Zeit, wo er Bankrott machte. Ein unbedeutender Fonds soll ihm,
aus der Freigebigkeit des Schwiegervaters herfließend, verblieben sein. Er hat sich dann in
Ostpreußen angekauft. Näheres ist mir unbekannt. Der jüngere Sohn, Carl Kunckel, studierte
beim Tode des Vaters in Berlin die Rechte und setzte das Studium fort, als die Mutter dorthin zog.
Er war lebenslustig, zog Vergnügungen vor und ergab sich auch dem Spiele. Er war aber schon
als Auskultator in Berlin angestellt, als die Mutter starb. Er gab die Laufbahn auf und kaufte das
Gut Altkirchen in Hinterpommern.
Ich habe nur der jüngsten Tochter des Onkel Christian zu gedenken. Dies ist die verwitwete
Obergerichtsrätin Andresse zu Berlin. Ich kann sagen, daß sie meinem Herzen teuer ist, als nahe
Verwandte und als sehr liebe Frau. Auch ihr verstorbener Ehegatte, der Obergerichtsrat und
Gerichtsdirektor der französischen Kolonie in Berlin war, war ein überaus guter und
liebenswürdiger Mann. Mit einem reichen Kindersegen war ihre Ehe ausgestattet. Zwei Söhne
sind verblieben. Mehrere Kinder nahm der Tod in der Jugend hin. Beide Söhne sind Ärzte
geworden, der ältere in Berlin, der jüngere im Oderbruch. Von den 5 Töchtern, ihren Schwestern,
ist die älteste seit vielen Jahren verheiratet an den Oberprediger Kuiewel in Danzig, die zweite an
den Professor Weise in Halle, die dritte an den Geheimen Hofrat Strenge in Berlin, die vierte
Caroline ist unvermählt geblieben bei der Mutter, die fünfte an den Hofrat Köhne in Berlin. Mit der
Familie Andresse bin ich sehr viel in Berührung gekommen, ich war jahrelang ihr Hausgenosse.
den Kaufmann und Kattunfabrikanten Haase zu Magdeburg verheiratet; sie war eine sehr liebe
Frau, von der mein Vater mit Zärtlichkeit sprach, wenn er ihrer gedachte; sie starb vor meiner
Geburt; meines Oheims Haase erinnere ich mich eher noch, er ist wenige Jahre nach meiner
Geburt verstorben. Aus seiner Ehe mit meiner Tante sind 3 Kinder verblieben, ein Sohn und 2
Töchter. Der Sohn hatte die Handlung gelernt und des Vaters Fabrikgeschäft. Er hatte keine
keine andere Fabrikstätte kennengelernt, als die väterliche. Seine Ausbildung als Fabrikant war
daher nur einseitig. Die großen Fortschritte, die ähnliche Fabriken machten, blieben ihm fremd,
ein besonderer kaufmännischer Sinn ist nie in ihm gewesen, und er war auch viel zu eigensinnig,
um den Worten wohlwollender Freunde Gehör zu geben, auch viel zu verschlossen, um sich
einem Freunde oder einem Verwandten zu entdecken. Durch alles dies bereitete er sein Schicksal
vor, seine Frabrik schlief ein, er mußte sein Geschäft am Ende ganz aufgeben, 1796 kam es über
sein Vermögen zum Konkurs. Sein Schicksal war umso beklagenswerter, als es mit einer Zeit
zusammentraf, wo in Magdeburg der Handels- und Gewerbestand blühte, und wo alles, was in
Magdeburg Kaufmann oder Frabrikant war, verdiente und Geld erwarb. Zum Glück hatte er keine
Kinder, nur seine Frau teilte sein Geschick. Beide Eheleute gingen nach Berlin und fanden bei
Andresse und seiner Frau ein Asyl. Durch dessen Bemühung wurde er Rendant bei dem
Generalauditorium. Er starb 1807 oder 1808. Seine Witwe verzog nach Zerbst, ihrer Vaterstadt.
Haase hatte 2 Schwestern. Der älteren, einer lebhaften Frau, hatte der Vater in ihrer Jugend
einen Mann aufgedrungen, den sie nicht mochte und mit Widerwillen nahm, den Hauptmann
Libeu zu Braunschweig. Sein Tod erlöste sie nach einigen Jahren. Er starb an der Auszehrung,
und die junge Witwe zog nach Magdeburg zurück. Nun fand sich ein dem Herzen und dem
Geschmack zusagender Freier, der Hauptmann von Kleist, der die einzige in der Ehe mit Libeu
geborene Tochter adoptierte, sie war etwa 1 Jahr älter als ich und ein wunderhübsches Mädchen,
heiratete mit 20 Jahren einen Major von Uttenhofen zu Torgau. Ihr Mann war derselbe General
dieses Namens, der nun schon seit Jahren in Frankfurt steht und dort eine Brigade-Infanterie
kommandiert. Herr von Kleist, der Stief- und Adoptivvater unserer Cousine, brachte es bis zum
Oberst und war derselbe Oberst von Kleist, der als Adjutant des Herzogs von Braunschweig die
Schlacht bei Auerstädt gegen Savoust mitmachte am 14. Oktober 1806, und als jener verwundet
vom Schlachtfeld nach Braunschweig und von da nach Ottensen bei Altona gebracht wurde, ihn,
unbekümmert um das Schicksal des Heeres begleitete und sich auch nicht weiter bemühte, nach
Preußen zum König zu gehen. Man hat ihm dies übel ausgelegt, indem man davon ausging, daß
er von den Schlachtplänen des Herzogs, als dessen Adjutant, unterrichtet gewesen sein müßte,
und daß, wäre er bei dem Heere geblieben, er wenigstens den anderen Generalen die nötige
Auskunft über des Herzogs Absicht hätte geben können. Alle Offiziere, die am 14. Oktober
gefochten hatten, oder in den folgenden Schlachten, mußten sich und ihr Benehmen 1807 nach
dem Frieden vor einer sogenannten Reinigungskommission rechtfertigen. Inwiefern dies dem
Herrn von Kleist gelungen ist, habe ich nicht erfahren. In den Dienst trat er nicht wieder, er bezog
sein Landgut bei Halle, wo er vor einigen Jahren verstorben ist. Bald nach ihm starb auch seine
Frau. Der hinterbliebene Sohn ist Regierungsrat in Erfurt; auch Töchter haben die von Kleist
hinterlassen, über die ich nichts weiß. Die jüngere Schwester der Frau von Kleist ist eine
verwitwete Scheidt in Magdeburg. Ihr Mann war dort Kammersekretär, er hätte gewiß eine
bessere Laufbahn gemacht, aber er starb schon im 30. Lebensjahr, weil er ein Lebemann und
dem Spielteufel verfallen war. Weder die Bitten seiner Frau, noch die ernstesten Vorhaltungen
seiner Freunde konnten ihn zurückhalten. Er hinterließ seiner Gattin 2 Töchter und einige tausend
Taler Spielgewinn. Die Mutter leitete mit Sorgfalt die Erziehung der Töchter, die im zarten Alter
den Vater verloren hatten. Beide waren hübsch und überaus liebenswürdig. Die ältere heiratete
den Oberlandesgerichtsrat Vetter in Halberstadt, die zweite, lebhafter und reizender als die ältere,
verband sich mit dem Oberlandesgerichtsrat Kleffel zu Magdeburg. Mit beiden Männern war ich
durch Freundschaft verbunden. Vetter war mein Jugendfreund und Kleffels Bekanntschaft machte
ich auf der Universität Halle. Leider entriß diesen wackeren Mann vor ungefähr 10 Jahren ein
bösartiges Nervenfieber seiner Familie, mit der er in glücklichen Verhältnissen lebte. Er hat 2
Söhne hinterlassen. Vetter lebt in Halberstadt und hat einen Sohn.
Ich komme auf das folgende Kind meines Großvaters, den vorgenannten Amsterdamer Onkel,
den merkwürdigsten in der Familie. Johann Benedict Schartow, geboren am 30. Mai 1734,
zeichnete sich schon als Knabe durch Lebhaftigkeit und Wißbegierde aus. Ein alter Bekannter
meines Großvaters, ein Amsterdamer Kaufmann, kam nach Magdeburg zum Besuch. Der
muntere Knabe gefiel dem Alten, er wünschte, ihn mit nach Holland zu nehmen, um ihn dereinst
in seine Handlung zu nehmen und sein Glück zu machen. Die Eltern willigten ein, der Kleine kam
nach Holland. Er sah die Mutter nie wieder. Er hat nur einmal noch in seinem Leben in Magdeburg
seinen Vater umarmen können, um in Holland nur zu früh sein Leben zu beschließen. Er bildete
sich in Amsterdam zum Kaufmann aus, ging aber noch als ganz junger Mann in die Dienste der
Ostindischen Kompagnie, und erhielt eine Anstellung in Batavia. Hier stieg er von einer Stelle zur
anderen und erwarb in vielleicht 15 Jahren ein Vermögen von fast einer Million Gulden. Um dies
möglich und erklärlich zu finden, bedarf es eines Rückblicks auf die damaligen Verhältnisse des
Handels. Die Zeit, in der mein Oheim in Ostindien wirkte und für sein Geschäft tätig war, ist die
des siebenjährigen Krieges, den die in demselben kämpfenden Seemächte, England und
Frankreich, fast in allen Weltteilen führten, in denen ihre Kolonien verbreitet waren. Holland war in
diesem Kriege (1756 - 1763, zur See eigentlich noch länger) bekanntlich neutral, und die
Holländer rissen daher während dieses Krieges den Seehandel überaus an sich. In welchen
Jahren mein Onkel eigentlich in Batavia gewohnt hat, ist mir nicht bekannt geworden. Das für
Europäer nachteilige Klima nötigte ihn, nach einigen Jahren nach Holland zurückzukehren. Seine
Gesundheit hatte indessen in Java gelitten und seine Konstitution soll nicht besonders stark
gewesen sein. Er starb schon am 1. Oktober 1776 in seinem 43. Lebensjahr zu Amsterdam. Ein
Ölgemälde von ihm befindet sich bei meinem Bruder in Magdeburg. Er war besonders Freund der
Malerei und der Musik. In seinem Nachlaß sollen sich schöne Gemälde befunden haben, die man
in Amsterdam verkaufte, da man ihren Wert nicht zu schätzen wußte. In seinem Dienst befanden
sich auch einige Musiker, so daß er eine persönliche kleine Kapelle gehabt hatte. Er muß mit
Aufwand in Amsterdam gelebt haben, denn sein in Ostindien erworbenes Vermögen war bei
seinem Absterben schon etwas geschmolzen. Er starb unverheiratet, mein Großvater war sein
Erbe.
Das letzte der Kinder meines Großvaters, die am Leben blieben, das siebente in der Reihenfolge,
war mein verstorbener guter Vater, Friedrich August, geboren am 26. Oktober 1737. Nach ihm
wurden dem Großvater noch 2 Kinder geboren, ein Sohn und eine Tochter, beide starben in der
Kindheit.
Mein Vater war in seiner Jugend kränklich gewesen, er hatte besonders an den Augen gelitten.
Mie er mich oft versichert hat, war er der Liebling der Mutter. Seine Kränklichkeit mag besonders
die Aufmerksamkeit der Mutter auf ihn gerichtet haben. Er erhielt eine Schulbildung, wie die
damalige Zeit sie geben konnte. Zur Erlernung der Handlung bestimmt, verließ er vielleicht schon
von Tertia aus die Schule und wurde vom Vater auf dessen Kontor beschäftigt. Dieser gab aber
bald nachher seinen Handel auf und wurde Schiffer und mein Vater bei ihm Buchhalter und
sogenannter Schiffsschreiber, bis er nach des Vaters Tode selbst Kurmärkischer Elbschiffer ward.
Magdeburger Schiffer war er schon bei Lebzeiten des Vaters. Bevor ich seiner weiter gedenke,
muß ich noch einmal auf meinen alten Großvater zurückkomen, den ich noch gekannt habe und
mich seiner Persönlichkeit sehr wohl erinnere. Er war im Anfang des vorigen Jahrhunderts,
wahrscheinlich 1706, geboren, mithin unter der Regierung Friedrichs I., der Preußen zum
Königreich erhoben hatte. Die Zeit seiner Geburt kann mit Recht eine sehr bewegte genannt
werden. Der Spanische Erbfolgekrieg und der Nordische verheerten damals Europa.
Seine Verheiratung und sein Etablissement, der Anfang seines Wirkens als Geschäftsmann und
Hausvater fällt in die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. Bei der Taufe seines 2. Kindes, einer
Tochter, lebte seine Mutter noch, denn sie ist als Frau Bürgermeister Schartow unter den
Taufzeugen des Kindes aufgeführt (1729). Die Nachricht von einer späteren Taufe eines 1739
geborenen Kindes gedenkt als eines Taufzeugen des Großvaters Bruders Christian. Auch eine
Schwester hatte mein Großvater, die an den Kanonikus Burghoff in Magdeburg verheiratet
gewesen ist. Daher unsere Verwandtschaft mit der Burghoffschen Familie, die aber im
Mannesstamm fast ausgestorben ist.
In einer besonders günstigen Vermögenslage ist zufolge der Überlieferung, die mir mein Vater
gemacht hat, der Großvater nicht gewesen, bis ihm wenige Jahre vor seinem Tode eine Erbschaft
anheim fiel, die aber auf die schmerzlichste Weise erworben werden mußte, durch den Tod eines
geliebten Sohnes. Am 26. Oktober 1761, also im Laufe des siebenjährigen Krieges, dessen
Verhängnisse auch ihn gedrückt hatten, verlor er seine Frau, mit der er 35 Jahre gelebt hatte,
sehr zufrieden und glücklich. Sie soll eine ganz vortreffliche Hausfrau und zärtliche Mutter
gewesen sein. An seinem ältesten Sohn hatte er nicht viel Freude erlebt. Übermäßige
Spekulationen, wohl auch Unfälle im Geschäft hatten ihn als Kaufmann bald gestürzt, sein Tod
folgte dem Verfall seiner Umstände, und dem Großvater fiel die Versorgung der Kinder anheim.
Auch für seine Schwiegertochter, geb. Rumpf, hat er redlich gesorgt. Der Enkel ging nach
Ostindien und fand dort seinen Untergang. Die Enkelinnen, die Kunckel und die Andresse
verheirateten sich demnächst. Die erste noch bei Lebzeiten des Großvaters. Zwei schon
verheiratete Kinder hatte er nun verloren, ein Sohn war in Ostindien tot, seine Frau hatte er auch
verloren, und so blieb ihm von seinen Kindern nur noch mein Vater, der einzige in der Familie, der
ihn in seinen Geschäften unterstützen konnte und dem er mit viel Liebe zugetan war. Er gab den
Handel auf und ward Schiffer. Ich muß mit wenigen Worten bemerken, welche Bewandtnis es mit
der Elbschiffahrt in Preußen damals hatte.
Die Befugnis, die Elbe mit Frachtschiffen von Hamburg nach Magdeburg und zurück, und ebenso,
sie von Hamburg aus bis Havelberg und von da die Havel und die Spree zu befahren und so
Kaufmannswaren zu verschicken, war Geschäft zweier privilegierter Korporationen, der
sogenannten Schifferbruderschaften, der Magdeburger und der Berliner. Das Magdeburger
Schiffsrecht war ein Privilegium personalissimum. Das Generaldirektorium (bekanntlich die
oberste Landesbehörde in allen Administrationsangelegenheiten bis 1806, wo es aufgelöst ward)
privilegierte einzelne qualifizierte Schiffer mit dem Recht der Schiffahrt. Dies Recht erlosch aber
mit dem Tode des Berechtigten, ging also nicht auf die Erben über, hatte mithin keinen
Kaufgeldwert, war auch nicht Gegenstand des Verkaufes, nur auf die Witwe eines Schiffers ging
es über. Das Berliner aber, die Befugnis von Hamburg und Berlin und so zurück, die Elbe, die
Havel pp. zu befahren, war ursprünglich an 24 Schiffer verliehen, in ihr Eigentum übergegangen,
war wie jedes andere Recht Gegenstand des Verkaufes, der Abtretung und der Vererbung. Ein
solches Schiffahrtsrecht kaufte der Großvater, hatte sich auch in Magdeburg Privilegium zu
verschaffen gewußt und betrieb bis an sein Lebensende beide Schiffahrten, oder ließ sie
eigentlich durch meinen Vater betreiben, der die Bücher führte, die Korrespondenz besorgte und
die Reise mit den Hauptschiffen mitmachte, so daß er in jeder Woche Hamburg und Berlin
besuchte. Alle und jede Schiffahrt wurde in einer bestimmten Reihenfolge der Schiffer betrieben,
die alle Konkurrenz beim Beladen ausschloß. Erst wenn der erste Schiffer seine volle Ladung
hatte, durfte der zweite zum Beladen schreiten, und so traf jeden die Reihe in einer gewissen
Ordnung, die aber insofern von seiner Tätigkeit abhing, als die Reise beim Wiederbeladen an
dem Bestimmungsort der Güter, vom Tage der Ankunft daselbst abhängig war. Gelang es dem
Schiffer auf der Fahrt andern zuvorzukommen, schneller seine Bestimmung zu erreichen und dort
bald auszuladen, so traf ihn das Wiederbeladen umso schneller. Die Schiffahrt war vormals ein
einträgliches Gewerbe, besonders wenn beide Privilegien in einer Person vereinigt waren, wie in
unserer Familie. Das alles hat sich jetzt geändert.
Ich kehre zu meinem Großvater zurück. Er hatte fast sein 70. Lebensjahr erreicht, als der betrübte
Todesfall seines Sohnes in Amsterdam eintraf. Der Nachlaß soll sich auf ca. 300.000 fl.
Holländisch belaufen haben. Mein Vater und der Schwiegersohn Haase wurden von alten Herren
nach Amsterdam deputiert, um die Erbschaft zu realisieren. Guten Willen hatten beide,
zuverlässig dieses Geschäft möglichst vorteilhaft für ihren Machtgeber auszuführen. Der eine
verstand es ebensowenig wie der andere. Unkunde der Holländischen Sprache tat das übrige. Sie
fielen gewissenlosen, vielleicht auch ungeschickten Advokaten in die Hände, und nach dem, was
mir der selige Vater über diese Angelegenheit mitgeteilt hat, haben sie nicht die besten Geschäfte
gemacht. Mein Vater hielt sich deshalb ziemlich lange in Amsterdam auf, machte viele
Bekanntschaften, er wußte manches Interessante von Holland zu erzählen. Damals war
allgemeine Ruhe, kein Krieg trübte der Holländer kaufmännische Gewerbe. Ein bedeutendes, zum
Nachlaß des Oheims gehöriges, einem öffentlichen Institut in Frankreich anvertrautes Kapital ging
sogleich verloren; das war durch Unkunde der Formen, die erforderlich waren, es einzuziehen,
geschehen, und ein bedeutender Abstoß mußte auch in Holland bezahlt werden. Von der
Langsamkeit, diesem bekannten Charakterzug der Holländer, der auch den dortigen
Rechtskonsulenten zu eigen ist, wußte mein Vater nicht genug zu erzählen, und ebenso oft
gedachte er oft ihrer Habsucht. Der eine Notar, der oft in der Erbschaftssache befragt werden
mußte, stand ihm nicht Rede, bevor nicht ein vollwichtiger Dukaten auf dem Schreibtisch lag. Da
dieser Mann vielfältig hat befragt werden müssen, so hat er dem Großvater eine Menge Geld
gekostet. Die Bevollmächtigten setzten den Nachlaß in bares Geld um, mit Einschluß schöner
Gemälde, die gewiß verschleudert wurden, da man ihren Wert nicht erkannte. Nur ein
Porzellanservice, Silber und Kostbarkeiten kamen nach Magdeburg. Ein Testament hatte der
Verstorbene nicht gemacht, in Holland aber gilt der Schiedfall, der auch in Magdeburg Grundsatz
ist bei der Intestaterbfolge, d.h. die Aszendanten schließen bei der Erbfolge in den Nachlaß eines
Kinderlosen und Unverheirateten die Geschwister desselben mit ihren Kindern aus. So fiel die
ganze, für damalige Zeiten bedeutende Erbschaft dem siebzigjährigen Großvater allein zu. Nun
ist ein bekannter Erfahrungssatz, daß ein unvermuteter und plötzlicher Zuwachs irdischer Güter
nicht immer den Erwerber beglückt, wie es seine Bekannten voraussetzen, besonders aber, daß
ein so durch Zufall erworbenes Vermögen selten mit Einsicht verwaltet und mit Mäßigung
genossen wird. Auch in unserer Familie sollte sich diese Wahrheit auf unangenehme Weise
bestätigen. Ich will es dem alten Herrn nicht für einen unweisen Gebrauch seines Geldes
anrechnen, daß er seinen Hausstand auf einen so glänzenden Fuß errichtete, wie reiche
Kaufleute in seiner Vaterstadt ihn gewöhnt sind, daß er Häuser kaufte usw. Dies war natürlich
und stand mit seinen Revenüen im Verhältnis. Etwas sehr Übles aber war es, daß er ohne
Sicherheit Geld auslieh, und daß er seines großen Vermögens Verwaltung einem Manne
anvertraute, der früher sein Vertrauen, leider auch das meines Vaters besaß, und es zum großen
Schaden beider mit Absicht auf seinen Vorteil mißbrauchte. Dies war der damalige Advokat und
nachherige Justizkommissarius Spengler zu Magdeburg. Dieser Mann überlebte meinen
Großvater um etwa 10 Jahre. Ich erinnere mich seiner noch sehr wohl. Er war mehr als
wohlbeleibt, ein Lebemann und besaß das sogenannte donus insiunandi (Schmeichelkatze) wie
sich alte Leute in meiner Jugend ausdrückten. Er hinterließ seiner Familie ein schweres
Vermögen, zu dem die Schartow'sche Erbschaft ungefähr 50.000 Taler beigetragen hat. Er war
offenbar vom Stamme "Nimm". Es ist mir noch gut erinnerlich, wie ihm bei uns der Rheinwein
schmeckte und wie er zu sprechen und zu erzählen verstand. Im Liquidieren für seine Geschäfte
war er Meister. Wenn er bei seinen täglichen Spazierritten bei dem Gruße mit Bekannten anhielt
und den im Fenster liegenden begrüßte und diesem auch nur ein Wort entfuhr, das als eine
Erkundigung nach der Lage seines Prozesses ausgelegt werden konnte, so standen 1 oder 2
Taler pro Colloquio auf der künftigen Rechnung - so weit habe ich es im Liquidieren noch nicht
gebracht. Üble, aber nicht unverdiente Nachrede über seine Habsucht verletzte den Mann noch
lange nach seinem Tode. Sein Vermögen hat den Kindern keinen Segen gebracht, er ist
schließlich diszipliniert worden. Ich komme später bei der Geschichte meines Vaters noch einmal
auf Spengler zurück, er spielte diesem einen argen Streich und brachte ihn um vieles.
Lange genoß der alte Großvater sein Vermögen nicht. Ein Schlagfluß tötete ihn plötzlich 1781; ich
war damals etwas über 5 Jahre alt und des alten Mannes Liebling. Die Liebe des Greises zu
meinem Vater hatte sich auf mich übertragen. Täglich mußte ich mit ihm nach seinem Garten
oder spazierenfahren, und sonst immer um ihn sein. Unstreitig hätte er mich verzogen, wäre ich
so länger um ihn gewesen. Ich erinnere mich, so sehr dies alles auch noch in die Jahre meiner
Kindheit fällt, noch mit vieler Bestimmtheit der Person des alten Großvaters, seines Kutschers,
der viel bei ihm galt, des Lehnstuhls, in dem er zu sitzen pflegte, und wie er mich liebkosend auf
dem Schoße hielt. Er war von meiner Größe ungefähr, nicht korpulent, aber doch stärker als ich;
in seinem Wesen schnell und hastig und dabei sehr guten Humors. Sein Tod, sein Begräbnis,
meine kleine in tiefe Trauer gekleidete Person, daß ich mit zur Leiche ging, die Auktion seines
Mobiliarnachlasses, alles dies ist mir noch sehr erinnerlich, wie denn überhaupt die Eindrücke, die
wir in unserer Jugend empfangen, die lebhaftesten sind. Er hatte kurz vor seinem Tode bestimmt:
Sein Nachlaß ginge in 3 Teile, von dem mein Vater, das einzig noch lebende Kind, ein Drittel
erhielt, ebensoviel erhielten die beiden Töchter des ältesten, längst verstorbenen Sohnes
Christian, die Kunckel und deren damals noch unverheiratete Schwester, die noch lebende
Andresse, und ebensoviel die Kinder der verstorbenen Haase, Jakob Haase und seine beiden
Schwestern, die Scheidt und die damalige Libeu. Mein Vater wurde indes wie billig begünstigt. Er
hatte seinem Vater mehr als 30 Jahre hindurch die Schiffahrt betrieben und ihm alle seine
Berufsgeschäfte fast ganz abgenommen, mithin sich sehr um ihn verdient gemacht. Er war ihm
auch lieber und seinem Herzen teurer als jene Enkel. Um die Verdienste meines Vaters zu
kompensieren, erhielt er die Berliner Schiffahrt als Prälegat, und das galt für bares Geld, es war
damals mindestens doppelt soviel wert. Auch erhielt ein Vermächtnis von 1000 Taler Geld. Der
alte Mann nahm die Achtung und Liebe derer, die ihn gekannt hatten, mit in sein Grab. Biederkeit,
Redlichkeit, und ein wahrhaft christlicher Sinn hatten ihn ausgezeichnet, er soll besonders auch
sehr wohltätig gewesen sein und freigebig, mehr als nötig gewesen wäre. Über seine
Verheiratung, die Geburten seiner Kinder und über die Todesfälle in der Familie hat er in einem
kleinen Buch das Nötige, obwohl dürftig, aufgezeichnet. Ich habe diesen Aufsatz, sogen.
adurtationes personalia bei dieser vorliegenden Arbeit benutzt. Von seiner Frau spricht er mit
Achtung und vieler Liebe. Er überlebte sie um 20 Jahre.
Ich komme nun auf meinen verewigten Vater. Seiner Geburt und seiner Erziehung gedachte ich
oben, des Zusammenhanges wegen. Das Glück lächelte ihm bei dem Eintritt in die Geschäftswelt
nicht. Zum Kaufmann hatte ihn der Vater nicht ordentlich ausgebildet, und ein förmliches
Etablissement als Kaufmann schienen auch die Familienverhältnisse nicht zuzulassen. Der Vater
bedurfte einer Unterstützung bei dem Betriebe der Schiffahrt, und der Sohn gab sich hin, diese zu
gewähren. In seine schönsten Lebensjahre fiel der siebenjährige Krieg, mit Begeisterung konnte
der Vater von der damaligen, so bewegten Zeit sprechen und von Friedrich dem Großen, dem
Helden seines Jahrhunderts. Als dieser nach der am 6. Mai 1757 gewonnenen Schlacht bei Prag
die geschlagene österreichische Armee in diese Festung einschloß, sie berannte und belagern
wollte, mußte schleunigst Belagerungsgeschütz herbeigeschafft werden, was die Armee nicht mit
sich geführt hatte. Es wurde aus dem Zeughaus zu Magdeburg geholt, und mein Großvater
übernahm die Verschiffung desselben bis in die Gegend von Prag. Alles ward mit großer Tätigkeit
und Schnelligkeit unter Mitwirkung dazu kommandierter Offiziere betrieben; mein Vater, damals
20 Jahre alt, hatte die Aufsicht über die Schiffe und begleitete diese. Ein angemessener
Wasserstand begünstigte die Fahrt, und nach 14 Tagen war das Geschütz schon in Böhmen
ausgeladen. Eine freundliche Einladung des Artillerieoberst Müller führte meinen Vater, dessen
Geschäft eigentlich beendet war, in das preußische Lager vor Prag. Er war nun Augenzeuge der
merkwürdigen Belagerung, von der er mir in meinem Knabenalter oft erzählte. Im Zelt des Oberst
hatte er sein Absteigequartier gefunden. Die verlorene Schlacht bei Collin, alias bei Planian in
Böhmen am 18. Juni 1757 machte bekanntlich die Aufhebung der Belagerung von Prag
notwendig. In seinem 24. Jahre verlor der Vater seine Mutter, die zufällig an seinem Geburtstag
starb. Im 25. Lebensjahre verheiratete er sich mit meiner seligen Mutter Sofie Henriette, der
zweiten Tochter des Kaufmanns Behrens zu Halberstadt am 10. September 1772, sie war im 18.
Jahre, soll hübsch, aber von einer zarten, nicht sehr starken Konstitution gewesen sein, und sie
ward dem Vater zu seiner großen Betrübnis nur zu bald entrissen. Bevor ich ihrer weiter gedenke,
muß ich notgedrungen abermals meine Erzählung mit einer Episode unterbrechen. Es handelt
sich darum, einige Kenntnis von der Familie Behrens zu geben. Der Vater meiner Mutter,
Friedrich Wilhelm Behrens, war aus Rudolstadt gebürtig, hatte die Handlung gelernt und war in
Halberstadt etabliert, wo er einen sogenannten Materialladen hatte, mit Vorteil nebenher die
Fabrikation von Wachslichten aller Art in einer wohl eingerichteten Wachsbleiche betrieb. Auch
betrieb er Garnhandel. Bekanntlich wird im Fürstentum Halberstadt viel Flachs gewonnen und im
Lande selbst zu Garn versponnen. Von den schönen Gebirgsgegenden seines Vaterlandes wußte
er mich oft zu unterhalten. Ein guter kaufmännischer Geist war nicht in ihm, er hatte auch, wie
sich bei seinem Tode ergab, nicht viel erworben, aber das vorhandene erhalten. Er war ein
Biedermann und die Gutmütigkeit selbst. 1748 hatte er sich mit der Großmutter, einer geborenen
Nürnberg, verheiratet. Das Andenken an diese vortreffliche Frau, die mich zärtlich liebte, die mir,
dem Enkel von einer geliebten, ihr nur zu früh entrissenen Tochter, so manche Freude zu bereiten
wußte, wird nie in meinem Herzen erlöschen. Geistvoller, gewandter als ihr Mann, liebte sie, so
lange es ihre Kräfte gestatteten das neben der Handlung bestehende Fabrikgeschäft und war
regsam und tätig in ihrem Wirkungskreise, eine vollendete Hausmutter. - Leider mußte sie am
Ende ihrer Tage den Untergang ihres zweiten Sohnes erleben, was den Abend ihres Leben
trübte. Die Großmutter war für jene Zeit eine fein gebildete Frau. Sie sprach glatt französisch, was
ihr im siebenjährigen Krieg im Verkehr mit der anspruchsvollen französischen Einquartierung sehr
zu statten kam. Mit Interesse habe ich oft ihren Mitteilungen aus jener Kriegszeit zugehört. Das
offene. wehrlose Halberstadt ward mehrmals im siebenjährigen Krieg von französischen Truppen
besetzt und geplündert. Ich konnte damals nicht ahnen, daß auch mir ein nur zu widerwärtiger
Verkehr mit solcher Einquartierung dereinst bevorstünde. Wie oft habe ich mich später dieser
Beschreibungen erinnert. Die Großmutter stammte aus vermögendem Hause, sie hatte in die Ehe
1748 12.000 Taler Gold gebracht.
Ich kehre nun von der Familie Behrens ab und meinem Vater wieder zu. Ich war als sein ältester
Sohn am 18. Juni 1775 in Magdeburg geboren. 1776 folgte mir ein Bruder, wenige Monate nach
seiner Geburt starb meine Mutter am 14. September 1776 an einem Nervenfieber, beweint von
dem Vater, dem eine zärtliche Gattin entrissen ward, und von den liebenden Eltern. Die
Großmutter nahm den kleinen 2 Monate alten Bruder nach Halberstadt, um seine Pflege zu leiten.
Der kleine Bruder starb aber bald darauf. Mein Vater schritt am 6. Mai 1777 als rüstiger Vierziger
zu einer zweiten Ehe mit Dorothea Magdalene Wilhelmine, der jüngsten Tochter des Ratsherren
Brömme zu Magdeburg, einer schönen, lebhaften Frau. Mit dieser hatte er drei Kinder: Mein
Bruder Wilhelm, geb. 9. Juni 1778, die beiden folgenden Friederike und August starben in der
Kindheit. Die Stiefmutter war lungenkrank. Der Tod des Großvaters am 31. Januar 1780 änderte
die Verhältnisse meines Vaters, meine Mutter hatte ihm kein bedeutendes Vermögen zugebracht.
Die zweite Frau war reicher, das hatte seine Umstände gebessert, und die Erbschaft vom
Großvater machte ihn für damalige Verhältnisse zu einem sehr wohlhabenden Manne. So
bedeutend aber, wie man hätte voraussetzen können, war das Erbteil nicht. Während der 5 Jahre,
in denen der Großvater das vom Sohne Christian ererbte Vermögen besessen hatte, war es so
geschmolzen, daß mein Vater zufolge der Erbteilung, außer dem ihm überwiesenen Hause als
das ihm zukommende Drittel des Nachlasses nicht volle 30.000 Taler Gold erhalten hat, und
doch hatte der alte Herr 1776 von seinem Sohn 200.000 Taler ererbt. Man sieht, wohin schlechte
Verwaltung führt. 1783 verlor der Vater die zweite Frau, am 11. Oktober. Sehr lebhaft ist mir die
letzte Zeit ihrer Krankheit erinnerlich, sie segnete mich und meinen noch sehr kleinen Bruder am
Tage vor dem Absterben auf ihrem Siechenbett, verehrte uns goldene Medaillen zum Andenken,
nahm von ihrem Mann mit großer Besonnenheit Abschied und bestätigte bald darauf, im
Todeskampfe der Sprache beraubt durch eine Bewegung mit dem Kopfe die Behauptung des am
Bette stehenden Arztes, daß sie jetzt sterbe. Unsere Gebete, des Vaters heißeste Wünsche
vermochten nicht, sie uns zu erhalten, ihre Stunde war gekommen, sie schied mit christlichem
Sinn. Noch wenige Tage vor ihrem Tode hatte sie geäußert, wie bitter der Tod sei! Sie hatte
Recht. Wenn eine 23jährige lebenslustige junge Frau vom Leben scheiden und verlassen soll,
was ihrem Herzen teuer war, so muß sie die Bitterkeit des Todes tief fühlen. Ihr zweiter Sohn
August folgte ihr bald, der Verlust des Töchterchens war früher gewesen. Meine Stiefmutter war
die einzige Tochter zweiter Ehe ihres Vaters und wurde von ihren Halbschwestern erster Ehe des
Vaters zärtlich geliebt. Eine derselben, Madame Morgenstern, die Verfasserin des sogenannten
Magdeburger Kochbuchs, eine literarische Erscheinung, die damals ihr Glück machte und
mehrere Auflagen erlebte, war ihr dediziert. Sie ist die Emilie, an welche die Anweisung
„schmackhaft zu kochen und dem Mann dabei zu ersparen“ gerichtet ward. Längst ist die
Morgenstern, eine intelligente Frau, in der Ewigkeit.
Mein Vater war nun zum zweiten Male Witwer in seinem 45. Lebensjahr, und ist entschlossen
gewesen, sich wieder zu verheiraten. Da trat zu ihm der Versucher in Gestalt des heillosen
Spengler, dessen wir oben gedachten, um ihm eine Frau aufzuschwatzen. Er mag ihm die
Notwendigkeit und die Freuden einer dritten Ehe genug vorgestellt haben. Der arme Mann ließ
sich wirklich überreden und feierte im Februar 1785 seine Verbindung mit der ältesten Tochter
des Oberamtmanns Runde zu Dreileben bei Magdeburg: Henriette! Wir Kinder freuten uns sehr
zu der neuen Mutter, die uns hernach teuer zu stehen kam. Spengler hatte förmlich den
Eheprokurator gemacht, mein Vater bezahlte seine Bemühungen mit 100 Friedrichsdor, der alte
Runde hat ihm dafür, daß er die Tochter an den Mann brachte, 100 Dukaten bezahlt. So wußte
der schlaue Spengler seine Klienten, seine sogenannten Freunde, auszunutzen. Die
Verheiratung, der Eintritt in ganz neue Familienverbindungen, gab dem Hauswesen einen
Umschwung. Unsere Stiefmutter liebte das Vergnügen über alles, und die überspannten
Vorstellungen, die sie von ihres Mannes Vermögen hatte, schienen Aufwand aller Art bei ihr zu
rechtfertigen. Der Vater, der gefälligste Ehemann, war nie ein strenger Wirt gewesen, er liebte
auch den Aufwand, den Geselligkeit herbeiführt, und er widersprach daher nicht, wenn die Mutter
oft große Gesellschaft zu sehen wünschte. Und so kam es, daß man „ein Haus machte“.
Equipage hatte der Vater schon vor der dritten Frau gehalten, sie wurde beibehalten, obwohl er
schon die Absicht gehabt hatte, sie abzuschaffen, und er ließ es an nichts fehlen, was der Mutter
Vergnügen machen konnte. Indes trübte sie bald seine Tage. Ihre Verschwendung ward ihm zu
arg, besonders ihre Neigung zum Spiel. Er war in den Jahren, in denen auch lebhafte Leute die
Ruhe lieben. Als nun die Mutter einen Liebeshandel mit einem Offizier, dem damaligen Leutnant
von Zochüschen angefangen hatte, wurde dies, wie billig, als eine Kriegserklärung angesehen. Es
kam zur Trennung, und der Scheidungsprozeß, der anständigerweise und mit Rücksicht auf das,
was die Weltklugheit gebietet, in wenigen Wochen zu beendigen gewesen wäre, ging leider durch
alle zulässigen Instanzen, kostete dem Vater schweres Geld, bereitete ihm Kränkungen aller Art
und hatte kein anderes Resultat, als daß die Ehescheidungsstrafe kompensiert ward. In dem
Prozeß gegen die ungetreue Frau verlor der Vater viel. Die Frau hatte ihm in den wenigen Jahren
der Verbindung an 10.000 Taler gekostet, was ich gern glaube. Der Scheidungsprozeß nahm
1791 oder 1792 seinen Anfang, und erst 1794 wurde die Ehe rechtskräftig getrennt. Spengler war
damals nicht mehr am Leben, er sah die Früchte seiner Umtriebe nicht. Aus Neigung hatte die
Stiefmutter Vater nicht geheiratet, sie war nicht mehr jung, als er um sie anhielt, weder schön,
noch liebenswürdig, mochte die Verbindung aber nicht ablehnen, um nicht ein Glück von sich zu
weisen, das sich darbot; sie schloß die Ehe nur, um nicht sitzen zu bleiben. Aber es wäre
ungerecht, nur ihrer Schattenseiten zu gedenken, sie hatte auch Lichtseiten, war eine tüchtige
Hausfrau und nahm sich der Erziehung ihrer beiden Stiefsöhne an, soweit es ihre Vergnügungen
zuließen. Nach einem Jahre nach erfolgter Scheidung heiratete sie ihren Liebhaber und bezog in
der Nähe des Vaters eine Wohnung. Der Vater hatte mit Wilhelmine Runde zwei Töchter, keinen
Sohn. Die ältere verloren wir schon in ihrem 6. Lebensjahre an der häutigen Bräune, die jüngere
Tochter, Wilhelmine, bei dem Tode der älteren noch Säugling, wuchs als ein schönes Wesen von
sanfter Gemütsart heran und gewann aller Herzen. Ihre Erziehung verblieb aber dem Vater,
freilich erst nach richterlicher Entscheidung.
Dem Vater waren nun aus 3 ehelichen Verbindungen 3 Kinder verblieben, jede seiner Frauen
hatte ihm ein Kind hinterlassen. Obwohl wir nur Halbgeschwister waren, so liebten wir uns doch
zärtlich, und der Vater versicherte oft, daß wir seine größte Freude und das Einzige wären, was
ihn noch an das Leben fesseln könne. Längst hatte er auf Verminderung seiner Ausgaben
Bedacht genommen. Seine letzte Ehe war noch nicht aufgelöst, als er die Equipage auflöste und
seine beiden Gäule verkaufte. Sein sehnlichster Wunsch war, seiner Kinder Etablissement zu
erleben. Diese Freude sollte ihm wenigstens in Ansehung der Söhne zuteil werden. Sein
Hausstand ward immer kleiner. 1793 verließen ihn beide Söhne. Mein Bruder ging zu einem
Kaufmann in die Lehre, und ich in demselben Jahr auf die Universität, nur Wilhelmine blieb ihm,
an deren Erziehung alles gewendet ward, was ihm erforderlich schien, wie er denn aus großer
Freigebigkeit keinen Aufwand scheute, den der Unterricht seiner Kinder erforderte. Ein alter,
treuer Buchhalter, Deneke, unterstützte ihn bei seiner Schiffahrt, die er fortdauernd betrieb. Als
dieser redliche Mann 1802 sich selbst als Schiffer einrichtete, war es nicht einmal nötig, ihn durch
einen anderen zu ersetzen. Mein Bruder etablierte sich damals als Kaufmann und bezog zu
meines Vaters großer Freude den oberen Stock des Goldenen Hirsches, beide bildeten nun einen
gemeinsamen Haushalt, und der alt und schwach gewordene Vater hatte nun den zweiten Sohn
als Haus- und Tischgenossen fortwährend um sich, der ihm auch als Buchhalter beistand. Ich,
seit 1798 in West- und dann in Süd-Preußen, war ihm zu fern, als daß Besuche möglich gewesen
wären. Im Herbst 1799 hatte ich ihn zuletzt besucht und gesprochen. Daß ich in meinem 24.
Lebensjahr angestellt und glücklich verheiratet war, und ihm wenigstens einmal im Monat schrieb,
hat sehr beigetragen, ihm seinen Lebensabend zu erheitern. Noch im Februar 1805 hatte er mir
geschrieben. Nach wenigen Wochen unterrichtete mich ein Brief meines Bruders von seiner
Krankheit, dem die Nachricht von seinem Tode zu meiner Bestürzung und tiefen Trauer nur zu
bald folgte. Er starb am 23. Februar am sogenannten Altersbrand in seinem 68. Lebensjahr.
seine größeren Spaziergänge beschränkte. Damals schaffte er auch das Reitpferd ab. Sein
ererbtes Vermögen ganz zusammenzuhalten, war ihm nicht geglückt. Die Verschwendung seiner
letzten Frau, sein Hang zur Freigebigkeit und mancher Unglücksfall in seinen Geschäften hatten
sein Vermögen nicht unbedeutend in Anspruch genommen. Außer den 30.000 Talern, die er vom
Großvater erbte, fielen ihm von seiner zweiten Frau ungefähr noch 10.000 Taler zu. Von diesen
Kapitalien war bei seinem Tode nichts vorhanden. Er hinterließ das Haus und die Schiffahrt, diese
mit einem großen Vorrat an Schiffen und Geschirr. Wir verkauften dieses und das
Schiffahrtsprivilegium für 15.000 Taler Gold; mein Bruder übernahm das Haus für 19.000 Taler,
es waren nicht unbedeutende Schulden zu bezahlen, indes erhielten wir doch jeder fast 10.000
Taler; der gestiegene Wert des Hauses und der Schiffahrt hatte die Erbteile so hoch gestellt.
Erziehung, Unterricht und jedes Vergnügen in der Kindheit bis ins Knabenalter hinein teilte.
Meines Bruders Neigung zum Kaufmannsstand trat schon früh hervor. 1784 kam er zur
Klosterschule Unser Lieben Frau in Magdeburg, die ich schon seit 2 Jahren besuchte. 1789 ließ
ihn der Vater die Handlungsschule besuchen bis Ostern 1793. Dann kam er in die Lehre zum
Kaufmann Kayser. 1802 etablierte sich der Bruder und nahm den jungen Kaliski als Kompagnon
an. Nach 6 Jahren schied Kaliski aus, an dessen Stelle später ein Herr Loose sein Gesellschafter
wurde. Im Mai 1805 verband sich der Bruder mit Henriette Walter, Tochter eines Fabrikanten in
Halle. Im Jahre 1828 ging sie wegen ihres Brustleidens nach Bad Ems, wo sie im August dieses
Jahres starb.
Nun zu meiner verewigten Schwester Wilhelmine. Noch an dem Tag, an dem mein Vater starb,
verlangte ihre Mutter, die noch in Magdeburg an den nun Hauptmann von Zschüschen verheiratet
war, von meinem Bruder die 17jährige Stiefschwester zurück. Der Bruder widersetzte sich und
Frau von Zschüschen suchte richterliche Hilfe nach. Der Schwester ward in der Person des
Justizkommissars Günter ein Vormund bestellt, und sie wurde einstweilen bei ihrer Tante Kunkel
untergebracht, weil sie auch selbst nicht zur Mutter wollte. Im Oktober 1807 verheiratete sie sich
mit dem Friedensrichter Heinrich zu Magdeburg, der bald darauf eine Anstellung als
Tribunalsrichter in Neuhaldensleben erhielt. Hier starb sie 1811 in der Blüte ihres Lebens, erst 22
Jahre alt, und hinterließ 2 Töchter. Die ältere folgte ihr bald in die Ewigkeit, die zweite, Agnes, ist
jetzt etwa 21 Jahre alt und bei den Verwandten ihres Vaters in Halberstadt. Mein Schwager
Heinrich ward bei der Reorganisation der Behörden 1814, als Preußen Magdeburg wieder erhielt,
Oberlandesgerichtsrat in Halberstadt.
Ich, Johann Friedrich Benedikt Schartow, bin am 18. Juni 1775 zu Magdeburg im Goldenen
Hirsch auf dem Breiten Wege geboren. Nach der Bestimmung meiner Mutter sollte ich keiner
Amme anvertraut werden, sie wollte mich selbst nähren. Nach 6 Wochen verließen sie aber ihre
Kräfte, und ich wurde mit Wasser und Zwieback genährt, daher ich auch nicht so kräftig geworden
bin wie mein Bruder. Im 15. Monat meines Lebens verlor ich schon die Mutter, hatte aber eine
sorgfältige Kinderfrau, die auch später für meinen Bruder bestimmt war. Sie starb erst, als ich
Referendar war, mein Vater hat ihr bis zu ihrem Tode eine Pension gezahlt. Als ich das 3.
Lebensjahr hinter mir hatte, wurde ich in eine Kinderschule geschickt. Man hatte damals den
Grundsatz, daß die Kinder früh lernen müßten, still zu sitzen. Im 10. Lebensjahr zu Ostern 1785
kam ich in die Klosterschule Unser Lieben Frau zu Magdeburg. Der Vater war zu wohlwollend, mir
eine Berufswahl vorzuschreiben, ich wurde nicht überredet, irgend einen Stand zu ergreifen. Den
Kaufmann wählte ich nicht, weil ich nicht Stetigkeit hatte, um schön schreiben und fertig rechnen
zu lernen, ich blieb in beiden sogar hinter meinem jüngeren Bruder zurück. Ich bestimmte mich
bald zum Studium und gewann den Wissenschaften Geschmack ab, mehr noch den Sprachen.
Schon im 12. Lebensjahr sprach ich französisch und verstand leichte lateinische Autoren.
Langsam rückte ich in den Wissenschaften vor, von denen ich, als ich in die höheren Klassen
kam, Geschichte, Erdkunde und Mathematik bevorzugte. Weil ich zu anderen Berufen keine Lust
hatte, bevorzugte ich und entschloß mich zum Jurastudium. Als mehrere meiner befreundeten
Mitschüler 1792 und 93 die Universität bezogen, machte ich Anstrengungen, ihnen nachzueifern
und bestand im August 1793 das damals erst eingeführte Abiturientenexamen. Am 16. Oktober
dieses Jahres fuhr ich nach Halle. Dort studierte ich fleißig, bis ich die juristische Theorie inne
hatte. Im August 1795 schloß ich mein theoretisches Studium ab und begab mich nach
Magdeburg zurück, um mich nun der Praxis zuzuwenden. Auf Vorschlag des Vaters fuhr ich nach
Berlin in das Haus des Oheims Andresse, um bei den Berliner Justizbehörden die praktische
Ausbildung zu betreiben, das war am 15. Oktober 1795. Am 22. desselben Monats wurde ich von
einer Deputation des Berliner Magistrats examiniert, und weil ich bestand, am 12. November bei
dem Magistrat zum Auskultator verpflichtet und am 13. bei dem Stadtgericht introduziert. Somit
war ich in den Gerichtsstand eingetreten. Die Arbeit wurde mir anfangs schwer, aber ich
gewöhnte mich ein, so daß ich nach 5 Monaten an das Kammergericht übergehen konnte. Am 11.
Februar 1794 bestand ich das 2. Examen als Referendar und wurde am 2. März introduziert.
Kaum hatte ich 6 Monate bei dem Kammergericht gearbeitet, da trieb es mich, möglichst bald das
3. Examen zu machen, um nur bald Assessor zu werden und mich weiter in der Welt umzusehen.
Auf eine Anstellung in Berlin konnte ich nicht rechnen, ich verlangte sie auch nicht. Mit dem
Examen hätte es gar keine Eile gehabt. Meine Jugend, meine geringe Erfahrung im Dienst und
meine in gewissem Sinn mangelhafte Weltbildung, hätten es mir wünschenswert machen
müssen, noch einige Jahre als Referendar zu arbeiten. Indessen hielt ich es für etwas
Erfreuliches, ganz selbständig zu sein, dem Vater nicht mehr mit Unterstützung zur Last zu fallen,
und andere Provinzen des Staates kennenzulernen, in denen mir eine Anstellung bevorstehen
würde. Ich meldete mich also im Herbst 1797 zu Probearbeiten, eilte dadurch allen Kollegen vor
und beschäftigte mich so unaufhörlich mit meinen Arbeiten, daß ich mir fast keine Erholung
gönnte. Im Sommer 1798 erhielt ich den Auftrag, das Justizamt Zinna zu verwalten; ich nahm ihn
gern an; meine eben fertig gewordenen Probearbeiten gestatteten die Entfernung von Berlin und
ich versprach mir überdies von der Verwaltung einer Unterrichterstelle Mehrseitigkeit in meiner
Ausbildung. An meinem Geburtstag 18. Juni 1798 fuhr ich dahin ab und blieb in Zinna bis 3.
September. Gern erinnere ich mich der heiteren Stunden, die ich dort im Kreise froher, guter
Menschen verlebte. Das Einfache ihrer Sitten, die Stille des Ortes, mein Wirkungskreis endlich,
wie verschieden fand ich alles von dem geräuschvollen Berlin und seinen Bewohnern.
Antrieb mehr, mit meinem Examen zu eilen, um bald heiraten zu können. Das Verheiraten der
Referendare und Assessoren war noch nicht Sitte, mehr als eine Rücksicht gebot es, den Rat
abzuwarten, um zu heiraten, und dies Ziel war für mich nicht fern. Am 22. September 1798 ward
ich zum Assessor examiniert, und so war das Ziel erreicht, nach dem ich so lange gestrebt hatte.
Meine Prüfung war so günstig ausgefallen, daß mir sogleich die Stelle eines Hofgerichtsrats in
Bromberg angetragen wurde. Ich war aber erst 23 1/4 Jahre alt, lehnte den ehrenvollen Antrag
meiner Jugend wegen ab und zog es vor, die Stelle eines Assessors bei der Regierung zu Thorn
anzunehmen, der „Rat“ konnte mir ohnehin nicht entgehen. Die 2. und 3. Teilung Polens 1793
und 95 hatten den Staat bedeutend erweitert. Man behandelte die Einwohner der durch die
Teilung des Landes an Preußen gekommenen Provinzen Großpolen, Masovien und einen Teil
von Podlachien und Polnisch Litauen so, wie Friedrich der Große 1772 bei der 1. Teilung Polens
die damals preußisch gewordenen Provinzen behandelt hatte, d.h. man gab ihnen deutsche
Beamte aller Art, die deutsche Sprache wurde bei den Gerichtshöfen und Verwaltungsbehörden
eingeführt, nach deutschen Gesetzen wurde gerichtet, und es war, als sei es auf Verwüstung aller
Nationalität abgesehen. Fünf große Justizkollegien und ebensoviel Kammern (jetzt Regierungen)
waren eingerichtet worden, und es erklärt sich hieraus, daß in den Jahren 1795-98 so viele junge
Juristen schnell befördert werden konnten. Für das Regierungskollegium in Thorn bestimmt,
verließ ich Berlin am 22. Oktober 1798. Mit der damals noch schlecht eingerichteten Post fuhr ich
an einem Montag Tag und Nacht und kam am Sonnabend früh in Thorn an, wo ich zuerst nichts
gut fand, als die Pfefferkuchen. Am 2. November wurde ich in Thorn vereidigt und introduziert und
hatte mich eines wünschenswerten kollegialen Verhältnisses zu erfreuen. Am 11. April 1799
wurde ich zum Regierungsrat ernannt. Da aber Thorn ein freudloser Ort war und dem Collegio
eine Versetzung nach Plock, einem noch schlechteren Orte bevorstand, so suchte ich meine
Versetzung nach Warschau nach und sah auch im Sommer 1799 schon meine Wünsche erfüllt.
Am 19. Oktober 1799 verließ ich Thorn und traf am 26. in Berlin ein, um meine Hochzeit zu feiern.
Am 1. November besuchte ich den Vater in Magdeburg, den ich so zum letzten Male sah, am 21.
November wurde bei meinem Schwager, Justizrat Bürgermeister in Berlin, meine Hochzeit
gefeiert. Am 26. reiste ich mit meiner Frau nach Warschau ab, wo wir am 7. Dezember eintrafen.
Meine Eindrücke dort habe ich in meinem Buche „Die Polen“ ausgedrückt. Mein Aufenthalt in der
alten Hauptstadt der Sarmaten ist mir die angenehmste Erinnerung aus meinem Leben. Ich stand
in den besten Lebensjahren, war glücklich und verheiratet, meine Stellung war finanziell
vorteilhaft, und ich lebte auch in angenehmen geselligen Verhältnissen. Beklagenswert nur blieb
es, daß man stark mit Arbeit überladen war. Der Dienst beschäftigte so übermäßig, daß für
Lektüre keine Zeit blieb, nicht einmal Zeitungen habe ich zusammenhängend lesen können. Das
Übermaß an Arbeit wird aus der Geschichte Polens erklärlich, eine ordentliche und genügende
Rechtspflege hatte man nicht gehabt. In Polen konnte man nicht Jura studieren, Polens Richter
waren Empiriker, wie im Mittelalter in Deutschland, die Okkupation von Südpreußen führte erst
dem Lande studierte Richter zu. Hatten Mängel in der Justizverfassung früher vieles
unentschieden gelassen, manches verzögert und verwirrt, trat nun Ordnung ein. Es war daher
kein Wunder, daß jetzt, wo Ruhe eintrat und sich der Wohlstand hob insbesondere des
Grundeigentums, dieses fast ausschließlichen Vermögens der Polen, eine Menge veralterter
Forderungen vor Gericht geltend gemacht wurden, deren Einziehung die früheren stürmischen
Zeiten behindert hatten, und daß man Erbschaften regulieren ließ, die vielleicht vor einem halben
Jahrhundert zugefallen waren. Man regulierte Grenzen, die seit Jahrhunderten streitig waren. Als
eine Merkwürdigkeit muß ich hinzufügen, daß selbst Privatverhältnisse königlicher Personen vor
das Ressort der Regierung zu Warschau gezogen wurden. Wir regelten das Kreditwesen des
Königs Stanislaus August Poniatowski, und ein anderer König, Ludwig XVIII von Frankreich,
damals Graf von Lille und im Exil, der in Warschau Zuflucht suchte und dort eine Zeitlang wohnte,
ward unter die Gerichtsbarkeit unseres Kollegii gestellt.
Am 6. November 1802 wurde Auguste geboren. 1805 machte ich eine Reise nach Berlin und
Magdeburg und 1807 mußte ich endlich Warschau infolge der Ereignisse des Jahres 1806
verlassen. Die verlorenen Schlachten bei Jena und Auerstädt und die bald darauf erfolgte
Einnahme Berlins, in das Napoleon triumphierend einzog, erfüllten die Preußen in Warschau mit
Trauer, die Polen aber mit heimlicher Freude. Die Vornehmen hatten längst ihr Vertrauen und ihre
Hoffnung auf Napoleon gesetzt, sie waren in beständiger Verbindung mit Frankreich geblieben;
nun schien die Stunde der Befreiung nicht fern. Als Posen besetzt war und die polnischen
Legionen aus Italien kommen sollten, zweifelte kein Pole mehr an der Herstellung seines
Vaterlandes. Am 27. November 1806 abends rückten die Franzosen ein, die Russen und Preußen
hatten am 15. November abends die Stadt verlassen und waren über die Weichsel gegangen.
Zeuge ihres Ausmarsches ergriff mich das wehmütige Gefühl, nun ohne Schutz einer Volksmasse
hingegeben zu sein, die Haß gegen Preußen im Herzen trug und die sich durch Mißhandlung oder
Plünderung der deutschen Beamten rächen wollte. Es blieb aber ruhig, was den verständigen
Anordnungen des Fürsten Joseph Poniatowski zuzuschreiben war, der in der kurzen Zwischenzeit
die Zügel der Regierung ergriffen und eine Bürgergarde eingerichtet hatte. Kaum hatten die
Franzosen Warschau besetzt, als die Polen unter der Führung des damaligen Herzogs von Cleve,
des nachherigen Königs von Neapel, Murat, die Verwaltung übernahmen, eine aus 5 Mitgliedern
bestehende Regierung einrichteten und mit der Auflösung der deutschen Behörden begannen.
Am 2. Dezember ward die Regierung aufgehoben und wir alle erhielten unsere Entlassung. Das
geschah nicht mit dem Anstand, den die Sache erforderte. Der polnische Repräsentant Wybicki,
ein verbissener Demagoge, hielt eine, in ihrem Eingang geruphafte Anrede an uns und an die
polnische Justizkammer, die sich uns gegenüber an dem Sitzungstische aufgestellt hatte. Er
stimmte sich aber bald zu förmlichen Schimpfreden herab, mit denen er unsere Regierung
überhäufte. Anwesende Polen mißbilligten dies aber, und niemand zollte ihm Beifall. So ward
denn unsere Existenz als Beamte vernichtet. Indessen kann ich mir den Vorwurf nicht machen,
als hätte ich hier den Mut verloren. Eine Wiedereinsetzung in mein Amt war nicht zu erwarten,
denn, daß Warschau nicht wieder preußisch werden würde, konnte man nicht bezweifeln. Ich
beschloß, alle Pläne für die Zukunft vorläufig auszusetzen, bis Friede geschlossen sei, und dann
nach dem Lande zu gehen, was Preußen verbleiben würde. Mein Unterhalt war gesichert, denn
ich war bei Kasse, schränkte mich aber möglichst ein und bezog im Frühling 1807 eine kleinere
Wohnung. Herr meiner Zeit, beschäftigte ich mich, soweit es meine Stimmung zuließ, mit
wissenschaftlicher Lektüre und suchte Beruhigung über die furchtbaren Ereignisse der damaligen
Zeit, die mich persönlich in ihr Verhängnis riß, in ihrer Vergleichung mit ähnlichen Verhältnissen
vergangener Jahrhunderte zu finden. Meiner Person geschah nichts zu Leide, ich mußte geben
und liefern, was der Krieg mit sich brachte und Einquartierung verpflegen, was aber jeden traf.
Drei- oder viermal mußten vollständige Betten an Militärhospitäler geliefert werden. Auch mit
Geldabgaben blieb man nicht verschont. Im Dezember 1806, Januar 1807 war die Stadt mit
französischen Truppen überfüllt, Napoleon mit der Garde und seinem Großen Hauptquartier
persönlich anwesend. Täglich sah ich den merkwürdigen Mann, von seinen Feldherren umgeben.
Sein Äußeres imponierte nicht, verkündete auch nicht den Helden. Vom 23. Dezember an, wo die
Gefechte an der Wilna begannen, bis zum 26. hörte man deutlich den Kanonendonner. Täglich
wurde eine Menge Verwundeter in die Stadt gebracht. Es war höchst interessant, dem
Kriegsschauplatz so nahe zu sein, aber mir und mehreren Freunden auffallend, daß man,
ungeachtet dieser Nähe, so wenig Bestimmtes und Wahres über das, was vorging, erfuhr. Die
öffentlichen Blätter, die man zu lesen bekam, entstellten alles, und die Schmähungen, die die
polnischen Zeitungen über Preußen brachten, waren schmerzlicher als das Unheil, das man
selbst erfuhr. Im Hause der meisten Familien ging alles drunter und drüber, und der Verkehr mit
der Einquartierung, Mißverständnisse, die aus Unkunde der Sprachen entstanden, und
Zufälligkeiten anderer Art führten mitunter seltsame Situationen herbei, und lächerliche Auftritte
machten oft das eigene Ungemach vergessen. Ich fand bald, daß Ruhe und Gleichmut das
Unabwendbare viel besser tragen lassen, als Ungeduld, und daß sich mit französischer
Einquartierung besser verkehren läßt, als mit deutscher. Mit meiner Einquartierung stand ich in
gutem Vernehmen, Artigkeit und Gewandtheit ist dem Franzosen eigentümlich und mit seinem
Wesen so vereinigt, daß selbst dem rohesten Soldaten etwas davon verblieb. Für freundliche
Anrede in seiner Muttersprache antworteten die Ärgsten, Offiziere verschiedenen Grades,
Zivilbeamte des Heeres, gemeine Soldaten: alle habe ich beherbergt und keinen gefunden, mit
dem nicht auszukommen gewesen wäre; manche schieden bewegt von mir. Einige Male habe ich
zwischen meinen polnischen Nachbarn und begehrlichen Franzosen, herbeigerufen, den
Vermittler gemacht. Meine Wohnung bestand aus einem Saale und 6 Zimmern, die Räume der
Dienerschaft nicht mitgerechnet. Den Saal bezog gleich ein französischer Oberst, der 4 Monate
blieb. 2 Zimmer bezog die sogenannte laufende Einquartierung, die durchmarschierte und oft
wechselte, mir verblieben 4 Zimmer. Beim Abmarsch unserer Garnison hatte mich der
Stabskapitän von Zepelin ersucht, mich seiner Frau anzunehmen, die er mit einem Kinde und 2
Domestiken zurückließ; sie erwartete in einiger Zeit ihre Niederkunft; sie war meine Cousine, eine
geborene von Burghoff, und beide mir befreundet. Er hatte seiner Frau, um sie nach seinem
Abmarsch vor Berührung mit den Kriegsereignissen zu schützen, eine kleine Wohnung im
obersten Stock des königlichen Schlosses zu verschaffen gewußt. Die Entlegenheit des Asyls
gewährte aber keinen Schutz. Die Ankunft Napoleons erfüllte alle Zimmer im Schloß mit seinem
Gefolge. Frau von Zepelin erhielt an einem Morgen im Dezember den Befehl zur Räumung in 1
Stunde und suchte bei uns Schutz; ich nahm die Frau auf und räumte ihr ein Zimmer ein, ein
zweites für ihre Leute. Nach einigen Tagen wurde sie entbunden und blieb bei uns bis Februar.
Ich war also mit Frau und Kind auf die beiden letzten Zimmer beschränkt, das eine war zugleich
Gesellschaftszimmer, wenn wir abends mit der Einquartierung den Tee nahmen. So hatten die
Zeitereignisse eigentümliche häusliche Verhältnisse herbeigeführt. Im Frühling ward es in
Warschau still. Die lästigen Einquartierungen nahmen ab, und als ich eine kleinere Wohnung
bezog, wude ich von ihnen verschont. Bemerkenswert war es mir und meinen Freunden, daß mit
Franzosen als Einquartierung weit besser auszukommen war, als mit ihren deutschen
Bundesgenossen, Bayern, Württemberger und Hessen befanden sich in Napoleons Heer. Alle
diese Krieger, die Befehlshaber nicht ausgenommen, waren gegen ihre Wirte ungleich
feindseliger, überhaupt roher als die Franzosen, und machten viel unbilligere Forderungen. Dabei
haßten sie einander, der Bayer verachtete den Württemberger usw. Nur in der Erbitterung auf die
Franzosen stimmten sie überein, obwohl diese ihre Alliierten waren.
Der Krieg hatte erklärlich die Verbindung mit Berlin unterbrochen, seit der Besetzung dieser
Residenz waren die Posten nicht mehr angekommen. Erst nachdem die Franzosen Warschau
besetzt hatten, ward der Postenlauf hergestellt. Ganze Pakete Berliner und andere Zeitungen und
zurückgebliebene Briefe kamen nun an und brachten die lang ersehnten Nachrichten aus
Deutschland, von den Freunden in Berlin und vom Bruder in Magdeburg. Als der Sommer 1807
begann, traf ich Anstalten, Warschau zu verlassen und beschloß, zunächst nach Berlin zu gehen
und dort das Kriegsende abzuwarten. Ich verkaufte die Möbel, so daß nur Betten, Wäsche und
die besten Wirtschaftsgeräte der Wasserfahrt anvertraut wurden. Meine Empfindungen bei der
Abreise von Warschau waren in der Tat sehr schmerzlich. Ich trennte mich von den Freunden, die
meinem Herzen teuer geworden waren, hatte meine Beziehungen dort aufgeben müssen, und die
Zukunft war dunkel, meine Existenz als Staatsdiener vernichtet und zu einer anderen Anstellung
gar keine Aussicht. Mein künftiges Schicksal mußte ich als abhängig betrachten von dem unseres
Vaterlandes, und das des letzteren war damals sehr ungewiß. Auch mein Vermögen mußte ich
fast ganz in Polen zurücklassen, ich hatte dortige Hypothekenkapitalien angekauft und erhielt nur
von einem Teile Zinsen. Ein angekauftes Haus war zum Glück schon vor dem Krieg verkauft. Das
Aufgeben so vieler freundschaftlicher Verbindungen und so manche Trennung für immer tat mir
weh. Einen Trost aber fand ich in der freundlichen Teilnahme, die mir achtbare Einwohner in jener
Zeit bewiesen hatten, und in den Winken, die ich schon damals erhielt, im Lande zu bleiben und
eine Anstellung an den neuen polnischen Behörden abzuwarten, die nach dem Frieden in die
Stelle der provisorisch eingerichteten treten sollten. Schon unmittelbar vor dem Einmarsch der
Franzosen hatte mir ein im österreichischen Teil von Polen angesessener Gutsbesitzer den
Vorschlag gemacht, zu ihm zu ziehen und so dem Krieg und seinem Schauplatze auszuweichen.
Der Plan wäre ausführbar gewesen, denn die Grenze war nah und des Freundes Gut nicht
bedeutend von ihr entfernt. Indes fand ich es doch bedenklich, in das Ausland zu gehen, da man
nicht wissen konnte, was über Ausgewanderte verhängt werden könnte - es unterblieb. Eine
Anstellung im polnischen Staate lehnte ich ab, hatte aber doch die Genugtuung, daß mir, als ich
schon in Küstrin als Justizkommissar arbeitete, eine Anstellung als Appellationsrat von dem
polnischen Justizminister Grafen Lubienski amtlich angetragen wurde. Am 31. Mai 1807 abends
verließ ich Warschau mit Frau und Tochter, die damals 5 Jahre alt war. Wir machten die Reise in
einem erst im Sommer 1806 gekauften neuen sehr schönen Halbwagen, und in Gesellschaft der
befreundeten Familie Hofrat Breusmann und Assessor [unleserlich], beide hatten auch ihre
Posten verloren.
Am 8. oder 9. Juni trafen wir in Berlin ein, es war ein wehmütiges Wiedersehen unserer Freunde
und Verwandten, wie war alles verändert. Eine französische Garnison fand ich statt der
vaterländischen Truppen, französische Beamte leiteten die Verwaltung, soweit sie die Einziehung
der Abgaben und die Administration der Polizei betrafen, eine allgemeine Niedergeschlagenheit
war auf den Gesichtszügen aller bemerkbar. Es war so still in der Residenz, wie ich es nie
gefunden hatte. Die Reise hatte ich ohne Behinderung zurückgelegt, ich war auf
Unannehmlichkeiten gefaßt, denn es begegneten uns täglich Truppen, die der Armee folgten, die
Napoleon damals in Ostpreußen und Polen aufgestellt hatte, sie ließen uns aber ungehindert
ziehen, und die französischen Befehlshaber respektierten meinen in Warschau ausgestellten, von
dem französischen Gouvernement beglaubigten Paß. In Berlin ward mir dieser abgenommen, ich
wurde als Fremder behandelt, mußte eine Sicherheitskarte kaufen, sie monatlich erneuern, wofür
eine Abgabe bezahlt werden mußte. Erst eine Zeit nach dem Frieden hörte diese belästigende
Einrichtung auf, die es übrigens nötig machte, daß ich mich oft persönlich auf der französischen
Kommandantur melden mußte. Ich machte hier die Erfahrung, daß die französischen Beamten
willfähriger und höflicher waren als die deutschen, welche das Berliner Polizeidirektorium der
Kommandantur zu Hilfe gegeben hatte. Berlin war erklärlich nicht mit Truppen überfüllt, da der
Kriegsschauplatz so weit entfernt war; nur Kadres, Depots und durchziehende Truppen, die in
Berlin eine Zeitlang lagen, um erst auf Kosten des Landes equipiert zu werden, bildeten die
militärische, von den Einwohnern zu verpflegende Einquartierung. Überaus zahlreich aber waren
die französischen Verwaltungsbeamten aller Klassen, die sich damals in Berlin etabliert hatten.
Man glaube nicht, die Verwaltung unter Napoleon sei etwas einfaches gewesen. In Berlin
residierten damals teilweise, und soweit sie nicht wegen ihrer Stellung bei der Armee sein
mußten, alle höheren und viele niedere Beamte, welche für die Verpflegung und sonstigen
Bedürfnisse des französischen Heeres zu sorgen hatten. Außerdem vermittelte eine zahlreiche
Beamtenwelt die laufende Verwertung der Finanzen im Wege der Kontrolle, unter welche die
preußischen Provinzialbehörden gestellt waren. Höhere preußische Behörden waren gar nicht in
Berlin. Andere französische Beamte hatten mit Regulierung der Zahlung der unerschwinglichen
Kriegskontributionen zu tun, die Napoleon dem Lande auferlegt hatte. Wie überaus peinlich
mußte den preußischen Staatsdienern das Treiben der französischen Behörden sein, ihr
Eingreifen in die Verwaltung, ihr Ungestüm, ihre Bestechlichkeit und ihr Eigennutz. Nicht nur ihre
Regierung sollte sich bereichern, auch sie waren darauf bedacht, durch den Umsturz zu gewinnen
und sich selbst zu bereichern. Auch der im Sommer 1807 bekannt gemachte ominöse Frieden zu
Tilsit änderte dies alles nicht. Nur langsam verließen die Franzosen unser Vaterland, Berlin, die
Kurmark überhaupt und Schlesien erst gegen Ende des Jahres 1809. Ich erinnere mich lebhaft
des Treibens in Berlin und der Bewegung seiner Bewohner, als an einem Sonnabend eine
allgemeine Erleuchtung der Stadt für den folgenden Sonntag angeordnet wurde. Am Montag
sollte der Friede publiziert werden. Die widersprechendsten Nachrichten über die
Friedensbedingungen trafen ein. Die Verständigen befürchteten das Allerschlimmste für Preußen
von der Politik Napoleons. Seine Ländergier und seine Begierde, Frankreich mit abhängigen
kleinen Staaten zu umgeben und durch deren Bildung zugleich seine Brüder zu Königen zu
erheben, ließen nichts anderes erwarten. Einzelne Leichtgläubige schmeichelten sich sich mit
Napoleons Großmut, mit der Fürbitte der schönen Königin Luise, der er nicht würde haben
widerstehen können. Der große Haufe war bei aller Niedergeschlagenheit doch durch die Aussicht
auf Frieden getröstet, weil er in ihm das Ende seiner Leiden zu erleben hoffte. Kontributionen,
Einquartierung, Lieferungen mußten nach seiner Ansicht aufhören, wenn der Friede bekannt war.
Die Erleuchtung war in der Tat glänzend. Ein wunderschöner Abend begünstigte die Beschauer
der wirklich großartigen Erscheinung, die Fassaden der Häuser so allgemein und prachtvoll
erleuchtet zu sehen, und man kann sagen, die Einwohnerschaft sei fast ganz auf den Beinen
gewesen, so ungeheuer war die Menschenmasse, die auf den Straßen Berlins hin- und herwogte;
auch ich hatte mich angeschlossen und mein Fenster erleuchten lassen. An unfreiwillige
Illuminationen hatten mich die Jahre gewöhnt in Polen. Seit dem Einzug der Franzosen am 27.
November 1806 in Warschau mußte jedes ihnen günstig erscheinende Ereignis durch
Erleuchtung der Stadt gefeiert werden, wirkliche und vermeintliche Siege der Franzosen. Das Fest
der Krönung des Kaisers, 2. Oktober, und andere oft unbedeutende Veranlassungen führten eine
Erleuchtung der Stadt herbei, die übrigens eigentlich nicht die Behörden befahlen, sondern die
von einzelnen an starken Getränken und Siegesnachrichten berauschten Patrioten ausging.
Durchzog ein solcher Haufen Polen abends die Straßen Warschaus, forderte er gebieterisch das
Anzünden der Lichter. Da hätte man Unrecht gehabt, das Verlangte zu unterlassen, denn mit dem
Einwerfen der Fenster wäre die Renitenz vergolten worden. Am Montag früh befriedigte die
Zeitung die Neugier aller, der Friede war französisch und deutsch zu lesen, man hatte nun
schwarz auf weiß über etwas, was die Brust so vieler bewegt hatte. Ich war gar nicht erschreckt
über den Frieden, ich hatte keinen besseren Ausspruch von Napoleon erwartet und den Frieden
nur immer und im voraus als seine Entscheidung über das Schicksal des Vaterlandes angesehen.
Die Urkunde über den Friedensschluß war auch demgemäß gestellt: Was Preußen behielt an
Land und Leuten ward ihm wiedergegeben, so drückte sich die Urkunde aus. Daß wir
Südpreußen verlieren würden, hatte ich längst als etwas angesehen, was sich von selbst versteht;
und die urkundliche Gewißheit, nun nicht mehr Staatsdiener zu sein, machte daher auf mich
weiter keinen schmerzlichen Eindruck. Ich kann aber nicht genug schildern, wie allgemein die
Niedergeschlagenheit in Berlin sichtbar wurde. Groß und gering, alles sprach sein Urteil aus. Nun
erst erschien dem Volke der Kampf gegen Napoleon, den wir unter so ungünstigen Umständen
begonnen hatten, als etwas unerhört Gewagtes und Törichtes, als unserer Mühsal und der
Geschicklichkeit unserer Heerführer gar nicht Angemessenes, und viele vergaßen sich in
schmähende Aussprüche über die Ratgeber des Königs, deren Verblendung den ungleichen
Streit herbeigeführt hätte. Andere schimpften auf den Kaiser Alexander von Rußland, der, nur auf
die Verteidigung seines ohnehin für Feinde fast unzugänglichen Landes bedacht, aus Mutlosigkeit
seinen Freund und Bundesgenossen, unseren Monarchen aufgeopfert hätte. Über den Kaiser
Napoleon schrie die Mehrzahl, sie sah in ihm einen heillosen, herrschsüchtigen Unterdrücker,
einen herzlosen Eroberer, einen blutdürstigen Tyrannen, und man vermutete, er werde mit der
Zeit doch noch nehmen, was er dem König gelassen hatte, auf immer sei Preußen erdrückt und
vernichtet. Doch auch er fand seine Verteidiger, die in seiner geistigen Größe, in seinem
entschlossenen Urteil als Heerführer und als Herrscher nur seine Bestimmung fanden, alles zu
unterdrücken, um dem in Weichlichkeit versunkenen Europa eine andere, für die Zukunft bessere
Gestalt zu geben. Er erschien ihnen als bloßes Werkzeug der Vorsehung zur Erreichung ihrer
Zwecke, die, wenn auch die Gegenwart verderblich und unheilbringend wäre, dereinst das
bessere herbeiführen würde. Die Politik hatte sich der gesellschaftlichen Unterhaltung fast ganz
bemächtigt, und die Flugschriften übelwollender Schriftsteller , die die preußische Regierung, ihre
Verwaltung, das Kriegsheer und andere Institutionen mit Heftigkeit angriffen und sich in
Schmähungen über den preußischen Staat vergaßen, gaben der Konversation über den Zustand
der Dinge und über deren Folgen immer neue Nahrung. Eine damals in Berlin erscheinende
Zeitung, „Der Telegraph“, der unter der Ägide der Franzosen redigiert wurde, brachte die Besten
fast zur Verzweiflung. Er war immer Organ, um Begebenheiten und Ereignisse aller Art in ein
solches Licht zu setzen, in dem sie ihrer Absichten nach erscheinen sollten. Alles schimpfte auf
den heillosen Telegraph und auf seinen Herausgeber, einen Herrn Lange, der die französische
Kokarde aufgesteckt hatte, um sich Mißhandlungen zu entziehen. Mit großem Interesse ward
aber doch diese Schrift überall gelesen. Niemand konnte damals die Wendung der Dinge ahnen,
die ihnen nach wenigen Jahren die Vorsehung gab. Damals entstand auch der Handel mit
Staatspapieren und anderen Effekten, die nun, keine Zinsen tragend und im Kurs gefallen,
Gegenstand der Spekulation und des Verkehrs wurden. In den Zeitungen erschien der Kurszettel,
um das Publikum über den Realwert der Effekten zu unterrichten - er wechselte vielfach.
Es steht das Bild der damaligen so traurigen Zeit in der Erinnerung zu lebhaft vor mir, als daß ich
mit Stillschweigen hätte übergehen können, was mich so sehr und so nahe berührte. Wenn ich
mehr als andere damals beobachtete, was alle bewegte, so ist es dadurch erklärlich, daß ich als
désoervé in Berlin umherging und mich kein Amtsgeschäft behinderte, alles zu lesen, was
erschien, und mich über das Öffentliche zu unterhalten.
Ich hatte eine lebhafte Sehnsucht, meinen Bruder zu sehen, auch ein Familienfest rief mich nach
Magdeburg, meine einzige Schwester war die Braut des Friedensrichters Hendrich (jetzt Präsident
in Breslau). Im Oktober sollte die Hochzeit sein. Noch vor meiner Abreise hatte ich zufällig in der
Zeitung gelesen, daß in Küstrin ein Justizkommissar gestorben sei. Obwohl es nicht meine
Absicht war, für immer Justizkommissar zu werden, so ward mir meine Geschäftslosigkeit so
lästig und unangenehm, daß ich den damaligen Chef der Justiz, den Kanzler von Schrötter in
Königsberg in Ostpreußen ersuchte, mich einstweilen in Küstrin als Justizkommissar anzustellen.
Ich hielt diesen Schritt selbst für erfolglos, denn ich befürchtete Konkurrenz anderer, vielleicht
noch bedürftigerer Staatsdiener und reiste in den letzten Tagen des Septembers 1807 nach
Magdeburg ab, wo ich einige herrliche Tage im Familienkreise verlebte und die trübe Stimmung
verlor, die mich in Berlin so bedrückt hatte. Auch hier war alles verändert. Die Magdeburger waren
über den ihnen widerfahreren Regierungswechsel nicht erfreut und auf ihren neuen König
Hieronymus Bonaparte, den ihnen Napoleon zugedacht hatte, nicht besonders zu sprechen, sie
mußten indessen zum bösen Spiel gute Miene machen. Mit Wehmut hatte sie der Abschied
erfüllt, den der König Friedrich Wilhelm IV von Memel aus in einem kurz gefaßten Erlaß an alle
seine vormaligen Untertanen der Provinzen richtete, die er im Tilsiter Frieden hatte abtreten
müssen. Von Memel aus wurde damals der dem König verbliebene kleine Staat regiert, sie war
die einzige ihm zur Zeit verbliebene Stadt, alles übrige war von den Franzosen besetzt, wenn
auch die Länder bis zur Elbe und Schlesien die Hoffnung hatten, dem Staate einst zurückgegeben
zu werden. In Memel war der König, seine Familie, sein Hof und die wenigen Minister, die damals
in Tätigkeit blieben. Kaum war ich 14 Tage in Magdeburg, als mich ein freundliches Schreiben
des Kanzlers Schrötter überraschte. Mein Gesuch war bewilligt, ich ward als Justizkommissar in
Küstrin angestellt. Mich erfreute dieser Wechsel meines Schicksals , denn die Aussicht, wieder in
Tätigkeit gesetzt zu werden, überwog alle Rücksichten. Meine Familie hatte aber nicht ganz diese
Ansicht. Küstrin war eine Festung, ein unangenehmer kleiner Ort mit Fieberkrankheiten. Ich
widerlegte aber diese Bedenken, und überdies war mir das Los jetzt gezogen. Ich verließ
Magdeburg am 1. November 1807, dem Geburtstag meiner Schwester, ohne zu ahnen, daß wir
einander nicht wiedersehen würden. Sie starb nach wenigen Jahren, so blühend auch ihr
damaliges Aussehen war.
In Berlin hielt ich mich nur so lange auf, als nötig war, mich für Küstrin einzurichten; ich mußte
mich vollständig möblieren, und das erforderte eine Menge Einkäufe. Teuer waren Möbel damals
nicht. Die allgemeine Not und das abnehmende Bedürfnis hatte alle Artikel dieser Art sehr im
Preise herabgedrückt. Ein heilloses Regenwetter erschwerte nur den Einkauf und den Transport
aller Sachen. Am 19. November 1807 traf ich mit meiner Frau Auguste in Küstrin ein, wo mir ein
alter Freund eine kleine Wohnung gemietet hatte, die ich später mit einer besseren vertauschte.
Ein neues Geschäftsleben, ganz verschieden von dem früheren, ein ganz anderer Geschäftskreis
sollte mich hier erwarten. Ich gestehe, daß meine Empfindungen bei dem Einzug in Küstrin nicht
die frohesten waren, ich versprach mir wenig von meiner neuen Stellung, die unter so
ungünstigen äußeren Verhältnissen gewählt war. Mit der bloßen Anstellung und meiner
Vereidigung, die nach wenigen Tagen erfolgte, war die Sache nicht abgemacht; es kam darauf
an, dem Publikum bekannt zu werden, und hinlängliche und gute Praxis zu haben. Indes fand sich
dies alles schneller und besser, als ich geglaubt hatte. In dem mir vorgesetzten Kollegio fand ich
alte Bekannte, man nahm sich meiner sehr an, und das Kollegium, die damalige Regierung, trug
sehr dazu bei, daß mir bald Geschäfte zuteil wurden. In wenigen Monaten war ich vollkommen in
Geschäftstätigkeit, was meiner Neigung zur Arbeit sehr zusagte. Der gesellige Verkehr in Küstrin
behagte mir nicht. Auf Tagesneuigkeiten, auf dieselben immer wiederkehrenden Scherze ging die
Unterhaltung, wissenschaftliche Fragen wurden nicht berührt. Die gegenseitige Bewirtung war
einfach. Die allgemeine Not legte überall Beschränkung auf. Küstrin war, wie sich versteht, mit
Franzosen überfüllt, so daß auch ich bald Einquartierung erhielt, die indes weniger belästigte, als
die in Warschau, man hatte ihr nur Wohnung und Holz zu verabreichen. Ich hatte anständige
französische Beamte, Leute von wissenschaftlicher Bildung zu Hausgenossen, so daß ich keine
Ursache zur Beschwerde hatte. Mit den bedeutenderen französischen Befehlshabern vom Zivil,
dem Intendanten der Provinz, den Zahlmeistern und anderen kam ich bald in Berührung. Dies
wurde mir nützlich. Napoleon hatte den Prinzen von Neuchâtel, Marschall Berthier die
westpreußischen Ämter Schöntanke und Schloppe bald nach dem Frieden von Tilsit geschenkt.
Dieser Friede ließ das bekannte, seit dem wieder längst untergegangenen Herzogtum Warschau
entstehen. Als der Prinz im Herbst 1804 von den Ämtern Besitz nahm, bestellte er den
kaiserlichen Intendanten zu Küstrin, Sabatier, zu seinem Bevollmächtigten. Dieser überließ mir
aber die Verwaltung beider Ämter mit Zustimmung des Prinzen, die ich bis zum Februar 1813
geführt habe, wo die russischen Truppen das Herzogtum besetzten und die Donatorine
Napoleons verjagten. Mein Wirkungskreis als Bevollmächtigter des Prinzen war mir ein
willkommener; übermäßig war die Arbeit nicht, die mir die Verwaltung auflegte; ich fand auch eine
Annehmlichkeit darin, daß ich fortwährend nach Paris zu schreiben hatte und dadurch mich in der
französischen Schriftsprache weiterbilden konnte.
Das Jahr 1809 führte Veränderungen für Preußen herbei, die auch Folgen für mich hatten. Die
Franzosen räumten in diesem Jahr die königlichen Staaten, und der Zar hielt seinen längst
ersehnten Einzug in Berlin, die Hauptstadt wurde dem König und seiner Familie wiedergegeben.
Napoleon ließ aber Preußen doch nicht ganz aus seinen Händen. Die Oderfestungen Stettin,
Küstrin, Geogan, jede mit einem kleinen Rayon, blieben von seinen Truppen besetzt. Wir
erhielten eine stärkere Garnison, sogar leichte Kavallerie. Man hielt es nicht für schicklich, die
Landeskollegien unserer Provinz in Küstrin zu lassen, was eine unfreiwillige Sperre derselben
leicht herbeiführen und eine Unmöglichkeit der Abgesperrten zur Folge haben konnte, die Provinz
zu verwalten. Die Verlegung der Kollegien ward daher angeordnet. Im Sommer 1809 wanderte die
Regierung nach Königsberg; das Oberlandesgericht, zu dem ich gehörte, wurde nach Soldin,
einem stillen Landstädtchen in der Neumark, verlegt. Beide Kollegien hatten, während ich in
Küstrin war, bei der damaligen Umformung der Administration ihre Namen verändert. Die
vormalige Kammer nahm den Titel Regierung an. Das Justizkollegium legte ihn ab und nannte
sich Oberlandesgericht. Im September 1809 begab sich das Kollegium mit allen Akten nach
Soldin. Jeder hatte früher, wenn von einer Verlegung des Kollegii als möglich gesprochen ward,
ein solches Ereignis als etwas Erwünschtes betrachtet, man fand den Aufenthalt in Küstrin wegen
seiner niedrigen Lage und wegen des zu vielen Wassers in seiner Umgebung ungesund, den
Aufenthalt in der Festung lästig, weil die frühzeitige Sperre der Tore nicht davon zu trennen war,
die geselligen Verhältnisse langweilig, und besonders die Gemeinschaft mit der französischen
Garnison unbequem. Jetzt, da sich ein Ereignis verwirklichte, das früher als etwas ungewisses oft
Gegenstand der Unterhaltung war, traten andere Ansichten hervor. Die Hausbesitzer unter den
Beamten klagten das Schicksal an, das sie von ihrem Grundbesitze trenne. Andere waren
mißvergnügt über die notwendige Trennung von Verwandten; fast jeder fand in der nun
unvermeidlichen Veränderung seines Wohnorts etwas Lästiges in dem Aufenthalt in einer kleinen
Landstadt, die mit dem besser gebauten Küstrin eingetauscht wurde. Auf Soldin war niemand gut
zu sprechen, keiner mochte die heitere Seite des Umzugs und der Veränderung hervorzuziehen.
Wie oft aber ist es im Leben so: Geht das, was man wünscht, in Erfüllung, so erscheint es in
einem anderen Licht. Der Umzug, den wenigstens heiteres Wetter begünstigte, hatte in der Tat
etwas Lächerliches. Fuhren von Akten mit einer Eskorte von Gerichtsboten, Kinder und
keuchende Greise, eine unermeßliche Reihe Wagen mit Hausgerät aller Art, endlich die Familien
in Reisechaisen, alles bedeckte die Landstraße und hatte den Sand zu vermahlen, der auf ihr
entgegen leuchtete. Die Verstimmung einiger über zurückgelassene vergessene Kleinigkeiten,
der Verdruß anderer über alte Möbel, die auf den Wagen zerbrochen waren, manches kleine
Mißverständnis, was nun einmal von Begebenheiten dieser Art nicht zu trennen ist, die wahrhaft
heitere Stimmung vieler, in die sie das Anschauen des bunten Gemäldes des Zuges versetzt
hatte, alles dies machte einen ganz eigenen Eindruck. Endlich fand doch jeder sein
Unterkommen, und man gewöhnte sich an das Neue.
Ich befand mich bald besser als in Küstrin. Die Luft in Soldin war unverkennbar gesünder, als in
der so tief liegenden Festung. Meine Wohnung, wenn auch kleinstädtisch, doch heiter. Ich
bewohnte ein ganzes Haus mit einem Garten. Ungleich wohlfeiler waren alle Bedürfnisse, und ich
befand mich mehr mitten in meinem Geschäftskreise, denn Soldin liegt mehr in der Mitte der
Provinz, was die Verbindung mit meinen Klienten erleichterte. Ich habe mich in dem stillen
Städtchen Soldin überaus wohl befunden und heitere Tage verlebt. Nur ein Ereignis trübte dort
später mein Leben - ich verlor meine Frau, mit der ich sehr glücklich gelebt hatte. Am 26. Oktober
1812 ward mir meine liebe, unvergeßliche Pauline geboren, 10 Jahre nach Augustes Geburt. Sie
hatte einen Geburtstag mit meinem verstorbenen Vater. Die Hoffnung, meine Familie vermehrt zu
sehen, hatte ich längst aufgegeben; das Schicksal wollte es anders, entriß mir aber später das
geliebte zweite Kind, das meinem Herzen teuer war. Meine liebe Frau litt seit dem Sommer 1811
an einem Husten, den keine Heilmittel fortnehmen konnten. Bäder, Arzneien, eine strenge Diät,
alles ward vergebens versucht. Nach Paulines Geburt wurde die Kur aufs neue betrieben, und sie
entschloß sich endlich im September 1813 zu einer Reise nach Berlin, wo ein ausgezeichneter
Arzt konsultiert werden sollte. Ich begleitete sie dahin und überließ sie der sorgsamen Pflege ihrer
Schwester, meiner Schwägerin Burgemeister. Nichts wurde unversucht gelassen. Die
Bemühungen des Geheimrats Fromey, einer der ersten Berliner Ärzte, waren aber ohne Erfolg.
Das Lungenübel war zu ausgebildet; unsere Wünsche vermochten die geliebte Schwester, die so
sehr geliebte Frau nicht zu retten. In den letzten Oktobertagen 1813 reiste ich noch einmal zu ihr,
gefaßt darauf, daß unser Wiedersehen das letzte sein würde. Pauline, damals etwas über 1 Jahr
alt, hatte ich mitgenommen, die Mutter sollte sie noch einmal sehen. Mein Herz war zerrissen in
der Stunde des Abschieds, denn der Zustand der Kranken war derart, daß man sich über die
nahe Auflösung nicht täuschen konnte. Auch von Auguste, die ich nach Berlin auch mitgenommen
hatte, nahm sie zärtlich Abschied. Am 7. November 1813 entschlief die Leidende zu einem
besseren Leben. In wenigen Tagen erhielt ich die Nachricht, auf die ich vorbereitet war. Den
Vater, die Schwester hatte ich verloren, ihr Verlust hatte mich tief betrübt. Jetzt war mir die so
liebevolle Gefährtin von der Seite gerissen. 14 Jahre hatten wir zusammen gelebt und
wechselnde Schicksale gemeinsam getragen. Mein häusliches Leben war verödet. Meine Kinder,
Pauline in zartem Alter ohne Mutter, so daß ich nicht ohne Schrecken an jene Tage zurückdenken
kann. Viel gefaßter und verständiger war meine Schwiegermutter, die sich damals in Soldin bei
uns aufhielt. Trauriger als den Winter 1813/14 habe ich nie eine Zeit meines Lebens verbracht.
Ich vermied jede öffentliche Gesellschaft und besuchte Privatzirkel nur, wo es nicht zu umgehen
war. Ich las und schrieb fast den ganzen Tag, soweit mich nicht mein Amt oder ein einsamer
Spaziergang vom Hause entfernte und fand in einer anhaltenden Anstrengung meines Geistes die
beste Erholung. Der wiederkehrende Frühling des Jahres 1814 erheiterte mich sehr. So einfach
und schmucklos die Umgebung von Soldin auch ist, jeder Spaziergang wirkte wohltätig auf
meinen trüben Sinn, und ich fand mich erleichtert, wenn ich im Freien gewesen war.
Die großen Ereignisse des Winters 1813/14 haben auch sehr dazu beigetragen, mich von
meinem Schmerz abzuziehen. Ich las wieder Zeitungen, die ich eine Zeit lang verschmäht hatte.
War man aber auch nicht tief ergriffen von dem, was wir damals erlebten? Was man kaum zu
hoffen wagte, was allen unmöglich erschien, wenigstens als ganz überaus unwahrscheinlich,
Napoleons Untergang, eine Umgestaltung in dem Verhältnis der europäischen Staaten auf einem
so heroischen Wege durch einen allgemeinen Krieg gegen den Eroberer und dessen so
glorreiche Erfolge, hat sich in einer kurzen Zeit ereignet. Daß die Völker Europas, namentlich die
Deutschen auf ein ganzes und auch nicht für ein halbes Jahrhundert so unterjocht werden
könnten, wie sie es in den letzten Jahren 1808 - 1812 waren, dafür bürgte mir die so gestiegene
Kultur unseres Zeitalters und auch die Erfahrung, über die die Geschichte lehrt, daß Despotien,
wenn sie von einem Soldaten ausgegangen sind, nicht übermäßig lange dauern. Große, durch
schnelle Eroberungen entstandene Monarchien haben sich nie lange gehalten. Ich rechnete aber
nur auf die Auflösung des großen Kaiserreiches nach Napoleons Ableben und darauf, daß
alsdann Erbfolgestreitigkeiten die Franzosen gegeneinander bewaffnen, und daß dann für die
Deutschen die Stunde der Erlösung schlagen, und daß die unfehlbar entstehende allgemeine
Vereinigung es zulassen würde, daß jeder früher vertriebene Dynast seine ihm entrissenen
Länder wieder in Besitz nähme. Dies zu erleben glaubte ich nicht. Der Fall ausgenommen, daß
Napoleon durch Meuchelmord fiele, und dies war als ein ungewöhnliches Ereignis nicht
wahrscheinlich. So ungefähr hatte ich mir die Zukunft idealisiert. Als Napoleon 1812 Rußland mit
Krieg überzog, waren die Ansichten über den Erfolg seines Angriffs überaus geteilt. Die Mehrzahl
versprach sich, Rußland werde nach Asien zurückgedrängt werden und seine Stellung als
europäischer Staat aufhören; oder es würde künftig eine Macht zweiten Ranges sein. Eine
Parallele Napoleons mit Karl XII sei ganz unpassend, und der Untergang Karls, dem seine
verfehlte Unternehmung gegen Zar Peter sei nur seiner Übereilung, dem zu weiten Marsch nach
dem Osten und dem Süden und seinen verhältnismäßig geringen Streitkräften zuzuschreiben.
Napoleons Heer übersteige das der Russen an Zahl, er und seine Marschälle seien geübtere
Heerführer als ihre Gegner, und Napoleon, von dem es überdies heiße, daß er die histoire de
Charles XII de Voltaire mitgenommen, werde bei dem Feldzug benutzen, was die Erfahrung, die
aus diesem Buche hervorgehe, an die Hand gebe. Andere augurierten, das Unternehmen werde
fehlschlagen und Napoleon nach einigen gelieferten Schlachten es von selbst aufgeben, als es
wohl mehr auf Erraffung von Geld, als auf Eroberung abgesehen sei. Einige hielten den Feldzug
wirklich nur für eine großartige Demonstration. Keiner konnte ahnen, daß jener Feldzug dem
unterdrückten Europa durch Napoleons Untergang eine andere Gestalt geben würde. Späteren
Geschlechtern wird es als Dichtung erscheinen, wenn sie lesen, daß alles gegen den aus
Rußland vertriebenen Eroberer zu den Waffen griff. Der unbeschreibliche Enthusiasmus der
Völker und ihre Treue, die unglaublichen Opfer, die von allen Seiten her hochherzig dargebracht
wurden, die übermäßigen Anstrengungen der Verluste der Kämpfer und des Kriegsschauplatzes,
der glänzende Erfolg stimmten zu einer ernsthaften und religiösen Ansicht. Auch Zweifler
bekannten, die Vorsehung sei im Spiele, und Gottes Vergeltung verfolge den Frevler, der alles
habe umstürzen wollen.
Durch Soldin zogen im Februar 1813 einzelne Abteilungen französischer Truppen, deren Zustand
Mitleid einflößte, einzelne Kosacken folgten ihnen schnell, und ich erlebte kleine Kriegsscenen in
Soldin. Ein Kosack plünderte vor meiner Wohnung einen Franzosen, zwei andere jagten einen
Haufen französischer Infanterie vor sich her. An einen Widerstand von Seiten dieser war damals
nicht zu denken. Bald erhielt ich russische Einquartierung , namentlich Kosackenoffiziere. Ich
kann nicht ohne Lachen an das alles denken, was durch die damaligen Kriegsereignisse
herbeigeführt ward. Auch das Ernste hat seine lächerlichen Seiten. Durch ein wunderliches
Mißverständnis hielten mich zwei bei mir einquartierte Kosacken für einen Arzt. Ich wurde über
den Zustand eines kranken Pferdes befragt und förmlich konsultiert. Da sie nur wenig polnisch
verstanden, und ich mich nur in dieser Sprache mit ihnen verständigen konnte, hatte ich einige
Mühe, ihnen deutlich zu machen, daß ich nicht Roßarzt sei. Die Kosacken waren übrigens, soweit
ich mit Ihnen in Berührung gekommen bin, gutmütig und in ihren Sitten einfache Menschen,
denen aber unsere gesellschaftliche Konvenienz, und das in ihr beruhende Schickliche und
Unschickliche fremd war. Geographische Kenntnisse hatten sie wenig, sie betrachteten damals
Paris als das Ziel ihrer Wünsche, glaubten sich nicht weit davon entfernt, und waren nicht wenig
erstaunt über die Entfernung, die ich ihnen auf Verlangen angab. Außer den Kosacken
marschierten auch Baschkiren und Kalmücken durch Soldin, von denen ich aber zum Glück keine
zu verpflegen hatte. Ihre Physiognomien bekundeten die mongolische Rasse. Zu der gehören
besonders die Kalmücken, eine auffallende Erscheinung. Alle sehen einander ähnlich, als ob sie
zu einer Familie gehörig, was auch erklärlich ist, weil sie sich mit keinem fremden Volk
vermischen. Platte Nase, kleine tiefliegende Augen, ihre gelbe Gesichtsfarbe, die übermäßg
starken Backenknochen, alles gab ihnen ein wunderliches, widerwärtiges Aussehen. Man sagt
vielleicht im Scherz, die Befehlshaber hielten sie bei der Meinung, daß bis zum Rhein alles noch
zu Rußland gehöre, um sie vom Sengen und Brennen abzuhalten.
Auch die Organisation des Landsturms gehörte zu den damaligen außerordentlichen
Erscheinungen einer so sehr bewegten Zeit. Männer vieler Stände, denen nichts so fremd war,
wie der Gebrauch der Waffen, mußten exerzieren lernen, und es war ein ein ganz eigentümlicher
Anblick, welche Leute von ganz verschiedenem Stande, Alter und sonstigen Eigenschaften zu
einem Zwecke vereinigt, dem der Verteidigung des Vaterlandes. Napoleon war endlich besiegt
und der Friede erkämpft. Der hierauf folgende Kongreß zu Wien sicherte dem Vaterland den
Besitz der Niederlausitz und eines Teils der Oberlausitz zu, Provinzen, die die Krone Sachsen
abtreten mußte. Dies führte Veränderungen in der Einteilung der an die Niederlausitz stoßenden
Regierungsdepartements herbei, und zu diesen gehörte die Neumark, in der Soldin liegt. Es
wurde ein ganz neu arrondiertes Departement gebildet, die Stadt Frankfurt zur Departementsstadt
ausersehen und daher auch zum Sitz der Regierung und des Oberlandesgerichts bestimmt. So
mußte ich dann abermals meinen Aufenthalt aufgeben.
Im Mai 1815 ward die Verlegung der Kollegien ausgeführt und ich begab mich in diesem Monat
nach Frankfurt/Oder. Ich gestehe, daß ich Soldin ungern verlassen habe. War dieses Städtchen
auch unbedeutend, und boten seine Häuser wenig Bequemlichkeit für die Bewohner und seine
Umgebung wenig Abwechslung für die Naturfreunde, man verändert in gewissen Jahren nicht
mehr gern seinen Aufenthalt, besonders nicht, wenn sich keine Vorteile darbieten, und diese hatte
ich nicht zu erwarten. Die Verlegung der Kollegien nach Frankfurt entzog mir einen Teil meiner
Einnahme, die ich nicht ersetzt erhalten habe, und der Aufenthalt in Frankfurt erforderte mehr
Aufwand als in Soldin. Der Hausstand kostete dort fast das doppelte, was sich aber durch den
höheren und vielseitigeren Lebensgenuß kompensierte. Frankfurt ist eine schöne Stadt und hat
sich in den Jahren meines Dortseins sehr verschönt. Alte Häuser sind niedergerissen. Die Tore
und Türme, die die Stadt von ihren Vorstädten trennte, sind verschwunden, aber ein elendes
Steinpflaster in den Straßen ist geblieben. Polizeiliche Einrichtungen andrer Städte werden sehr
vermißt, wenn sie auch der undankbarte Zweig der Verwaltung ist und mehr Tadel als Lob erfährt.
Seit ich in Frankfurt wohne, sind 19 Jahre verflossen, und in diesen hat sich im Vaterland viel
geändert. Das Kriegsheer wurde neu organisiert, der Soldat menschlicher behandelt, die
Privilegien des Adels auf Offiziersstellen aufgehoben, die Juden zu Staatsbürgern erhoben, in
Berlin eine Universität gestiftet usw.
Die andern deutschen Bundesstaaten trafen ähnliche Veranstaltungen, und die Gesellschaft hat
seit Napoleons Erscheinung und Untergang große Fortschritte gemacht. Seine Eingriffe in die
Länder Deutschlands, in alle Verhältnisse deutscher Staaten haben neben dem Unheil, das sie
mit sich führten, auch wohltuende Folgen gehabt. Die Fürsten lernten besser regieren, die Völker
wurden befreit von fremdem Druck, den die Mehrzahl erfuhr, mehr denn je auf Fleiß und
Betriebsamkeit verwiesen, und alle lernten die Segnungen des Friedens kennen. Wie ein
zerstörender Orkan auch wohltätige Folgen zurückläßt, so bedarf auch die politische Welt zu ihrer
Reinigung physischer Ereignisse. Napoleons Auftreten, die Erschütterung, die er allen mitteilte,
haben Kräfte erweckt über das, was Not tut, und so der Gesellschaft wesentlichen Nutzen
gestiftet. Insbesondere hat die Industrie große Fortschritte gemacht und der Handel eine ganz
neue Gestalt angenommen. Eine Menge Kunststraßen, verbesserte Anstalten des Postwesens,
Vereinfachung der Abgabensysteme, und viele andere Institutionen haben die Betriebsamkeit
vermehrt, die Völker einander näher geführt, und vieles zum Wohle der Menschen treten lassen,
wenn auch einzelne dadurch Not erfahren haben. Fast alle Fabrikate sind billiger geworden,
ebenso die Produkte des Landes. Seit dem allgemeinen Friedenszustand in Deutschland hat auch
die Lust am Reisen zugenommen. Vergnügungsreisen waren früher nur Reichen vorbehalten und
Wißbegierigen. Bäder und Gesundheitsbrunnen besuchten früher nur wirklich Kranke, und der
Glaube an ihre Heilkraft war auch gar nicht so allgemein. Wie sehr verschieden ist hier das Einst
und das Jetzt. Bequeme Posteinrichtungen, Straßen, bessere Gasthäuser, die allgemein
verbreiteten Schnellposten, Ausländern nachgeahmte populäre Schriften über die
Sehenswürdigkeiten des Landes und der Städte, das alles erleichterte das Reisen, was ohnehin
der Geist der Zeit zu einem Bedürfnis Gebildeter erhoben hat. Wenn der Sommer eintritt, so ist
es, als habe sich die halbe Generation auf die Reise gemacht. Die Landstraßen sind mit
Reisenden erfüllt, und selbst der Fußreisende, früher der Handwerksbursche, allenfalls dem
Sondertyp vorbehalten, ist allgemein geworden. Ein zu Fuß Reisender hatte sich sonst keiner
besonderen Aufnahme im Gasthaus zu erfreuen, der Wirt hielt ihn für einen armen Schlucker oder
gar für einen Verdächtigen. Jetzt ist man daran gewöhnt, Leute aller Stände mit einem Tornister
auf dem Rücken und einem Wanderstabe Fußreisen machen zu sehen. Insbesondere sind in den
Sommermonaten die Bäder mit Besuchern überfüllt. Viele Heilquellen sind nämlich erst entdeckt
oder angepriesen durch Ärzte oder Schriften zu einem Ruhm gelangt, den sie nicht hatten. In
allen Bädern sind die angemessensten Anstalten zur Aufnahme der Kurgäste und Besucher
getroffen. Die Fortschritte in der Chemie haben es möglich gemacht, die Bestandteile der
Heilquellen besser zu analysieren, die Heilkunde hat ihren Gebrauch objektiv erweitert. So
strömen ganze Züge Reisender in die Bäder, viele aber nur zum Vergnügen. - Die Badereisen
sind förmlich Mode geworden, es gehört zum guten Ton, zu reisen. Dem Gelehrten, dem
Geschäftsmann, den sein Beruf an den Schreibtisch gefesselt hat, ist Unterbrechung von den
beschwerlichen Geschäften seines Berufes, die Bewegung, die die Reise herbeiführt, die
verschiedenen Eindrücke des beständigen Wechsels der Gegenden und Bilder auf einer Reise
eine willkommene Kur. Geistig und körperlich befindet man sich am besten, wenn man nach
zurückgelegter Reise sich wieder zu den Arbeiten seines Berufs wendet. Eigene Erfahrung
hierüber hat mich wohltätig belehrt. Außer einer kleinen Harzreise hatte ich noch keine
Vergnügungsreisen gemacht. Seit 1816 aber bin ich fast alljährig und meist begleitet von meiner
Frau auf Reisen gewesen. Ich habe abwechselnd Schlesien, Böhmen, die Rheinlande, Wien und
Salzburg besucht, war öfter in Dresden. Ich bin aber noch gar nicht so weit gekommen, wie man
jetzt gewöhnt sein muß, um den Ansprüchen zu genügen, die an einen Weltmann gestellt werden.
Paris und Italien muß man gesehen haben, um vor der Gesellschaft bestehen zu können. In
meiner Jugend waren solche Fahrten etwas unerhörtes. Jetzt machen fast alle jungen Leute, die
auf süddeutschen Hochschulen studieren, in den Ferien die Fußreise über die Alpen. So hat sich
die Reiselust ausgedehnt. Ihre Quelle ist aber nicht überall Wißbegierde, sondern vielfach
Genußsucht und Eitelkeit.
Ich lernte im Sommer 1815 meine zweite Frau kennen, wir feierten am 16. Dezember desselben
Jahres unsere Verbindung. Auguste Ernestine, geb. 7. November 1785, jüngste Tochter des 1806
in Berlin verstorbenen Kammerdirektors Stubenrauch, Schwägerin des damaligen
Kammerdirektors, jetzt pensionierter Geheimer Oberfinanzrat Ludolf und der Geheimrätin
Borsche. Am 1. Oktober verlobten wir uns, die Hochzeit ward im Borscheschen Hause gefeiert.
Die Bekanntschaft des Stubenrauch hatte ich als Referendar in Berlin gemacht. Seine Frau war
die Tochter eines seinerzeit berühmten Berliner Arztes, Geheimrat Mutzel. Meine Frau ist eine
vortreffliche Gefährtin, sie hat sich in guten und bösen Tagen als eine getreue und trostreiche
Hausfrau bewährt, und große Verdienste um die Erziehung meiner Kinder erworben, die sie
hauptsächlich leitete, da ich als Geschäftsmann [? Beamter!]an den Arbeitstisch gefesselt war.
Der Kammerdirektor Stubenrauch war Jurist, früher auch Kammergerichtsadvokat, war zweimal
verheiratet. Seine erste Frau, geb. Scholtz, Tante meines Schwiegersohnes Scholtz, hat nur eine
Tochter geboren, Frau Stosch in Sonnenburg. Diese hat das herbe Schicksal erfahren, daß von
ihren 13 Kindern nur 3 am Leben blieben. Die zweite Frau, geb. Muzell, hatte folgende Kinder:
1. Wilhelmine, verh. Borsche, kinderlos
2. Amalie, 2. Frau des Borsche, Kinder
3. Henriette, verh. Ludolf, 1 Sohn - kinderlos
4. Ernestine-Auguste, verh. Schartow, 2 Söhne
5. Wilhelm, Landrat in Soldin, Gutsbesitzer in Denz, Neumark
6. Carl, Gerichtsrat in Frankfurt, Söhne Herrmann und Rudolf
Die beiden Söhne mit meiner Frau Auguste sind:
1) Friedrich Adolf Schartow, geb. 30. Sept. 1817 [Mein Großvater]. Seine Paten am Tauftag 16.
Nov. 1817 waren:
Hoffmann, Frau Regierungsrat Stosch, Frau Geheimrat Herford. Außerdem sind auf dem
Taufschein noch folgende Taufzeugen vermerkt: Frau Präsident Brassewitz aus Potsdam;
Frau Ludolf, Berlin; Hofrat Lentze, mein Schwager 1. Ehe, Berlin; Geheimer Oberfinanzrat
Borsche; Landrat Stubenrauch; mein Bruder Kaufmann Schartow in Magdeburg; Geheimrat
Berend, Berlin
2) Friedrich Wilhelm Gustav Schartow, geb. 30. Mai 1819, getauft 15. Juli. Zeugen seiner Taufe:
Oberlandesgerichtsrat Behrend; Regierungsrat Steinkopf; Carl Stubenrauch, Assessor in
Frankfurt; Regierungsrat Stosch in Sonnenburg; Frau Konsistorialrat Probsen in Potsdam;
Frau Regierungsdirektor Kessler, geb. Heim, Tochter des Dr. Heim in Berlin; Frau Referendar
Kienitz; Frau Borsche; Frau Antonie Stosch; Frau Auguste Scholtz, meine Tochter aus erster
Ehe.
Letztere hatte sich am 21. Nov. 1821 mit Rat von Scholtz verheiratet. Am 2. Febr. 1829 verloren
wir unsere Tochter Pauline aus meiner ersten Ehe. Sie ruht auf dem evang. Friedhof in Frankfurt.
Ihr Grab bezeichnet ein einfaches Kreuz. Sie starb im 17. Lebensjahr an den Folgen einer
Lungenentzündung. - 1834, der 1. Januar, war für mich ein Unglückstag. Es war heilloses Wetter,
der Regen ergoß sich, und ein heftiger Sturm tobte. Ich ließ mich nicht abhalten, gegen Mittag
einige Besuche zu machen, um Freunden zum Antritt des neuen Jahres Glück zu wünschen. Als
ich auf dem Rückweg war, hatte der Sturm zugenommen. Ich war meiner Wohnung schon
ziemlich nah und ging, ganz in einen großen Mantel gehüllt, den ich umgeworfen hatte, auf dem
Trottoir. Der Sturm warf mir den Mantelkragen in die Augen, ich tat einen Fehltritt in den Rinnstein
und fiel links in die Fahrstraße hinein. Ich hatte Mühe, mich liegend aus dem Mantel zu wickeln,
der linke Arm schmerzte mich heftig, er war beschädigt, ich konnte mich nicht aufrichten, ich war
des linken Fußes nicht mächtig und fühlte, daß er gebrochen sei. Zwei herbeigerufene Männer
brachten mich in meine Wohnung. Bald erschien ein herbeigeholter Wundarzt, der meinen
Zustand untersuchte. Nach seiner Versicherung war der linke Schenkel ausgerenkt, d.h. der Hals
des Schenkelbeines aus der Pfanne gewichen, in welcher er, sich bewegend, den Oberleib trägt.
Ein außerdem noch requirierter erfahrener und geschickter Wundarzt, Dr. Hohenhorst,
untersuchte meinen Zustand nur ganz oberflächlich, schien dem Urteil des ersten Chirurgen
beizutreten, und man traf Anstalten, den linken Schenkel einzurenken, ihn zu reponieren.
Besonders gut zu Mute ward mir bei diesen Anstalten nicht. Zwei Handtücher wurden mir unter
die Arme gezogen, und um jeden Fußknöchel band man auch ein Handtuch. Dr. Hohenhorst legte
ein fünftes Handtuch um den kranken Schenkel, knüpfte seine Enden zusammen, zog seinen
Rock aus und steckte den Kopf in die Schlinge, die er durch das Zusammenbinden der starken
Handtücher hatte entstehen lassen. Auf seinen Schultern lag das obere Ende der Schlinge, sich
erhebend hob er zugleich den Schenkel, konnte ihm also jede beliebige Bewegung geben und
hatte dabei beide Hände frei, um die Reposition mit ihnen ungehindert erreichen zu können. Der
Fuß schmerzte nicht, auch als man mir den Stiefel auszog, hatte mir dies nicht mal weh getan.
Jetzt verlangte der Arzt, daß ich langsam auseinandergezogen wurde. Vier Männer waren
herbeigerufen. Zwei zogen an den Handtüchern unter der Achsel, zwei an den Füßen, und so
ward ich vielleicht 1/2 Zoll lang auseinander gereckt, was mir heftige Schmerzen verursacht, den
ein im rechten Bein eintretender Krampf noch vermehrte. Ich verlor aber die Fassung nicht und
erfreute mich der guten Anstalten zu meiner Herstellung, die sich besonders nur auf mechanische
Operationen beschränken mußte. Ein Glas Wein ward mir nach geschehener Reposition
überreicht. Nun erklärte der Arzt, die Voraussetzung, als sei der Schenkel nur ausgerenkt, wäre
eine Täuschung; der Hals des Schenkelbeins sei gebrochen, der obere Teil gar nicht aus der
Pfanne gekommen, die beiden Enden des gebrochenen Knochens schienen aber durch die
Operation zusammengefügt zu sein, meine Herstellung sei nicht zu bezweifeln, ein langes Liegen
aber in einer ganz horizontalen Lage müßte ich mir gefallen lassen und mich allen Anordnungen
unterwerfen. Für den Erfolg könne er aber nicht einstehen, Erlahmung pflege fast immer zu
folgen, denn eine Verkürzung des gebrochenen Gliedes sei nicht zu vermeiden. Hierin lag wenig
Trost, aber doch Hoffnung. Für den Augenblick galt es nur, einer Entzündung vorzubeugen. Dazu
wurden um die Bruchstelle herum Umschläge mit Eisbeuteln Tag und Nacht gemacht. Dazu
bekam ich bis zum 7. Januar nur Hafergrütze als Suppe oder Getränk, und täglich eine Scheibe
Weißbrot mit Butter. Bei dieser Einschränkung der Ernährung befand ich mich besser, als man
glauben sollte, ich war vollkommen fieberfrei und fühlte mich ziemlich wohl, nur das Liegen wurde
stündlich lästiger. Am zweiten Tage schon diktierte ich Briefe und las die Eingänge. Am 7. Januar
kündigte mir der Arzt an, es müsse eine Maschine aus Berlin verschrieben werden, in die ich
eingeschnallt und eingespannt werden müßte, um jede Bewegung des Beins zu verhindern. Fast
vor einem Jahr war solch eine Maschine erfunden. Früher hatte man in meinem Falle den
Kranken im Bett festgebunden, oder den betroffenen Knochen in nassen Sand gebettet, um ihn
zu fixieren. Am 11. Januar wurde die Maschine angelegt, sie hat mich nicht wenig gequält, ich
muß aber ihrer trefflichen und zweckmäßigen Einrichtung alle Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Sie bestand aus einem Holz in Gestalt einer Dachlatte in Verbindung mit einem Brett. Dieses
diente, die Füße dagegen zu stemmen. Die Latte war an die gesunde Körperseite gelegt und
reichte bis in die Achsel, Gurte und Riemen befestigten es an Fuß und Schenkel, ein Leibgurt um
den Unterleib. So wurde das gesunde Bein festgeschnallt, daß ich es kaum zu rühren vermochte.
Die Fußsohle konnte ich gegen das Brett stemmen, und an dieses Brett wurde der kranke Fuß
festgeschnallt und nach ihm zu ausgedehnt. Die Ausdehnung war überaus schmerzhaft, denn das
kranke Bein hatte sich zusammengezogen durch die Schenkelmuskeln , fast um 1 Zoll verkürzt,
und es galt nun, ihm seine frühere Länge wiederzugeben. Über den Knöchel ward ein Ledergurt
geschnallt und mit Riemen nach dem Brett zu gezogen. So weich und schön dieser Gurt auch
war, nach wenigen Tagen entzündete sich die Haut an der Berührungsstelle. Die Entzündung
nahm so zu, daß Eintritt des Brandes befürchtet wurde, und der Fuß mußte durch ein anderes
Band oberhalb des Knies fixiert werden. Dies führte aber Anschwellung des ganzen Fußes herbei
und mußte aufgegeben werden. Der Arzt wechselte mit der Art der Befestigung des Fußes am
Bett, behielt aber den Zweck der Kur im Auge. Ich war zu beklagen: innerlich gesund lag ich so,
daß ich nur den rechten Arm und den Hals bewegen konnte. Ich wurde wie ein Kind gefüttert.
Über dem Bein war der linke Arm vergessen, er war festgeschnallt. Der Unterarm dadurch so mit
Blut erfüllt, daß er alle Regenbogenfarben hatte. Bei einer Untersuchung ergab sich, daß ein
Stück des Knochens am Ellenbogen abgebrochen sei. Es schob sich hin und her, und nun wurde
der Arm eingeschient und mit vielen Kompressen umgeben. Ich konnte ihn gar nicht gebrauchen,
was die Beschwerden noch mehr steigerte. Bei meiner angeborenen Ungeduld und Regsamkeit
wurde mir das sehr lästig. Erleichtert wurde nur mein Schicksal durch die liebevolle Pflege meiner
Frau. Schließlich ging aber alles besser, als ich glaubte. Zu meinem Glück konnte ich meine
Geschäfte im Bett weiter betreiben, was sehr dazu diente, mich zu erheitern und aufrecht zu
erhalten.
Endlich am 1. März wurde ich für 1/4 Stunde auf das Sofa gehoben. Der gebrochene Knochen
war geheilt, denn ich konnte den Fuß bewegen, er kürzte sich aber, aus der Maschine
gekommen, sichtbar, daher man sich beeilte, mich wieder einzuschnallen. Endlich schlug doch die
Stunde der Erlösung. Am 21. März ward mir die Maschine abgenommen. Meiner Fesseln
entledigt, lag ich kläglich im Bett, denn ich hatte den Gebrauch meiner Füße ganz verloren, auch
nicht die Kraft, mich aufzurichten. So hatte unterbrochener Gebrauch der Muskeln sie aller Kraft
beraubt. Am 23. März verließ ich auch das Bett und wurde auf das Sofa gelegt. Stehen und gehen
konnte ich noch nicht. Erst am 1. April, also 3 Monate nach meinem Unfall, wurde ein Versuch
gemacht, mich auf Krücken zu stellen. Beim linken Fuß wurde die Verkürzung im Stiefel
ausgeglichen. Es hatte sich aber, von den Ärzten vorausgesagt, die Haut an beiden Fersen
abgelöst und durch eine, sehr zarte neue ersetzt, sodaß ich nur unter Schmerzen auftreten
konnte, bis ein neuer Kallus entstanden war. Am 5. April versuchte ich, von meiner Frau und
einem Stock unterstützt, zu gehen. Es gelang zu meiner Freude. Am 27. April wagte ich
auszugehen und zwar zum Mittagessen bei meinem Schwager Oberlandesgerichtsrat
Stubenrauch. Treppenbenutzung und Ein- und Aussteigen am Wagen machten mir mit den
steifen Gliedern noch Beschwerden. Am 1. Mai wagte ich, das Pflaster zu betreten und ging nun
täglich aus in Begleitung eines Dieners, den ich anfassen konnte. Am 26.5. betrat ich wieder das
Oberlandesgericht und konnte mich nun wieder ganz meinem Beruf widmen. Im Juli fuhr ich zur
Badekur nach Teplitz, die ich 1835 wiederholte. 1836 besuchten wir Dresden, 1834 Freienwalde.
1838 fuhren wir über Dresden, Leipzig und Halle nach Magdeburg zu meinem Bruder. Das Reisen
geht jetzt schneller, Eisenbahn und Dampfschiffe vermitteln den Verkehr. Aber auch die
Postfahrten sind verbessert. Wir fuhren mit der sogenannten [unleserlich]-Post abends 7 Uhr von
Magdeburg ab und waren am Morgen früh 7 Uhr in Berlin. 1839 fuhren meine Frau und ich in das
schlesische Bad Obersalzbrunn, um meinen Husten los zu werden. Auch 1840 reiste ich nach
Magdeburg, wo am 15. Mai die Hochzeit meiner Nichte Bertha mit dem Kaufmann Humbert
stattfand. Ich nahm auf der Durchreise in Berlin meine Tochter Auguste mit. Ich blieb eine Woche
bei meinem Bruder und freute mich, in den Räumen, wo ich meine Kindheit verlebt hatte,
verweilen zu können. Das Hochzeitsfest war durch einen Polterabend und ein splendides Diner
ausgezeichnet. Im Juli begab ich mich wieder nach Obersalzbrunn zur Wiederholung der
vorjährigen Kur, den Rückweg nahmen wir über Warmbrunn nach Dresden, wo wir eine Woche
blieben. Am 16. Dez. wollten wir unsere silberne Hochzeit feiern. Da kam die Nachricht von dem
plötzlichen Tode des Präsidenten Einbeck in Berlin, mit dem wir sehr befreundet waren. Deshalb
unterblieb der Polterabend, zu dem Vorführungen usw. geplant waren. Wir begnügten uns mit
dem vorgesehenen Mittagessen im Familienkreise. Leider waren mein Sohn Adolf (Heidelberg)
und mein Bruder verhindert, teil zu nehmen. Meine Tochter mit ihrem Mann Scholtz waren
anwesend.
Am 19. Oktober 1842 erlitt ich einen Unfall, der mir für immer eine sehr schmerzliche
Rückerinnerung sein wird, denn er hat meine Erlahmung herbeigeführt, mich also zum Krüppel
gemacht. Ich bin heut, fast 2 Jahre nach dem Unfall noch lahm und muß mich zum Gehen außer
dem Hause eines Dieners bedienen, im Zimmer genügt ein Stock. Die Aussicht, vollkommen
hergestellt zu werden, habe ich längst aufgegeben, wenn sich auch mein Zustand nach und nach
gebessert hat. Der Mechanismus des Fußes ist noch immer gestört, wenn ich ihn auch etwas
besser gebrauchen kann, als im ersten Jahr nach dem Fall. An jenem Tag war ich zum Grafen
von Bouverot, der jenseits der Oder wohnte, zum Abendessen geladen. Ich ging schon abends 9
1/2 Uhr zurück, da ich spät abends zu essen nicht liebte. Es war trübe, ein schwacher
Mondschein beleuchtete die Oderbrücke spärlich, und in dem ebenen Teil der Brückenstraße war
es ziemlich dunkel. Baugerüste vor einem Hause benahmen das geringe Mondlicht. Es hatte
geregnet, und ich hatte das Unglück, auf einem nassen Stein auszugleiten und zu fallen, und
zwar mit der rechten Hüfte auf die scharfe Kante des Rinnsteins. Ich fühlte sogleich eine heftige
Erschütterung meiner Hüfte, erhob mich und überschritt mit Mühe unter Schmerzen den
Rinnstein, erreichte das nächste Haus, lehnte mich an die Wand, und vermochte nicht weiter zu
gehen. Ein Vorübergehender bot mir seine Hilfe an und brachte mich nach Haus. Ich ward mit
weiterer Hilfe die Treppe hinaufgetragen und bettete mich auf das Sofa meiner Schreibstube in
heilloser Aufregung. Der Arzt stellte eine Quetschung des Hüftgelenks fest und erklärte, die
Heilung wäre nicht zweifelhaft, aber langsam. Nach 14 Tagen konnte ich das Bett verlassen und
wie früher das Sofa benutzen. Ich ließ mir die Krücken von meinem ersten Unfall bringen, und mit
ihrer Hilfe lernte ich wieder meine Glieder gebrauchen. Ende Mai 1843 fuhr ich endlich in
Begleitung meiner Frau nach Teplitz zum Gebrauch der dortigen Heilbäder. Im Herbst stellten
sich die alten Kräfte wieder ein, und ich konnte zu Fuß ausgehen, beschränkte meine Gänge aber
auf das Kasino, wohin ich ohne Steinpflaster gelangen konnte. Zu dem Bureau auf dem
Oberlandesgericht mußte ich fahren. Der Winter war weniger freudenlos für mich, als der vorige.
Ich fuhr in Gesellschaften und besuchte einige Male das Schauspiel. Der Winter 1843/44 war mit
dem Wetter sehr wechselnd. Der Frühling 1844 belebte mich sehr, ich machte längere Gänge,
selbst bis zum Oberlandesgericht, auch über die Oderbrücke und sah mit Sehnsucht dem Tage
entgegen, wo ich nach Teplitz abreisen könnte. Am 19. Juli reisten wir nach Dresden und trafen
am 23. In Teplitz ein, wo mir die Badekur wieder sehr wohl tat. Ende August fuhren wir nach
Dresden zurück und trafen mit Gustav [sein Sohn] zusammen, der ein Kommando in Magdeburg
hatte. Wir fuhren gemeinsam bis Spremberg, wo uns Gustav verließ, um über Muskau nach
Magdeburg zurückzukehren. Auch 1845 besuchten wir Teplitz, weil ich mich noch nicht der
Krücken entledigen konnte und mich auf meinen Gängen immer noch begleiten lassen mußte
wegen des steinigen Pflasters und der Fuhrwerke. Aber nicht die Hoffnung auf Heilung des Fußes
durch die Badekur bestimmte mich zu der Reise, sondern die Ansicht, daß Badekuren allen alt
Gewordenen wohltätig sind, die Sehnsucht nach einer Erholung von meinen Geschäften und nach
dem schönen Teplitz. Am 16. Juli verließen wir Frankfurt und trafen am 18. in Dresden ein. Bei
dem Eintritt in Böhmen wurden wir viel revidiert, mehr als sonst. Der Grund lag in der zufälligen
Anwesenheit eines höheren Beamten. Am 15. August erhielt ich von meinem Bruder die mich so
sehr betrübende Nachricht vom Tode seines ältesten, schon dem mehr als Jahresfrist
gemütskranken Sohnes Wilhelm. Die Sektion hat ergeben, daß auf seine, von uns allen so sehr
ersehnte Herstellung nicht zu rechnen war, denn es hatte sich in dem größeren Gehirn ein
Gewächs gefunden. Diese Erscheinung klärt es auf, daß die Zerrüttung des Geistes vorausgehen
mußte. Er war ein sehr liebenswürdiger Mensch. Mein Bruder hat die Freude, ihn als Kaufmann in
Magdeburg etabliert zu sehen, nicht lange genossen. Ich sprach meinen Bruder im Oktober in
Berlin. Zu meinem Kummer fand ich ihn sehr angegriffen. Ich fand, daß er sehr älter geworden
aussah, was er auch bestätigte.

Forstmeister
geboren 03.10.1853 in Frankfurt (Oder)
gestorben 28.02.1933 in Naumburg
Hier schließt der Aufsatz, den der Verfasser, Justizkommissar Johann Friedrich Benedikt
Schartow, in Freienwalde im August 1831 bei der Gelegenheit einer Brunnenkur verfaßt hat. Er
wohnte weiter in Frankfurt. Dort feierte er am 30. August 1846 sein 50jähriges Amtsjubiläum,
wobei ihm mancherlei Ehrungen zu teil wurden. U.a. stifteten ihm seine Kollegen von der
Regierung zur Erinnerung an diesen Tag einen silbernen, innen vergoldeten Pokal, der am Fuß
die Namen der Stifter eingraviert enthält: Aschenborn, Bardeleben, von Beyer, Hannemann,
Hintze, Joch..., Keller, Kern, Marquard, Mittke, Preusse, Tirpitz, von Thielenfeld, Ulrici, Vogel.
Zehn Jahre später am 7. Oktober 1856 ist er verstorben und auf der von ihm begründeten
Erbbegräbnisstelle auf dem Friedhof zu Frankfurt beigesetzt worden, wo schon seine ihm
vorangegangene Tochter Pauline ruhte. Seine Frau Auguste verließ Frankfurt und zog nach ihrer
Heimatstadt Berlin, wo auch ihr ältester Sohn Adolf wohnte. Dort verstarb sie am 10. August 1860
und wurde gleichfalls in Frankfurt auf dem alten Friedhof neben ihrem Gatten, mit dem sie in
41jähriger glücklicher Ehe vereint gewesen war, beigesetzt. Aus dieser Ehe stammen ihre beiden
Söhne Adolf und Gustav. Der ältere, Adolf, ist am 30. Sept. 1817 in Frankfurt geboren, seine
Paten auf der am 16. Nov. stattgefundenen Taufe sind bereits vorher verzeichnet. Dessen Sohn,
Adolf Friedrich Benedict Schartow schreibt nun vom Leben seines Vaters: Er hat nichts
Schriftliches, das über sein Leben Auskunft geben könnte, hinterlassen. Deshalb will ich mich
bemühen, von seinem Leben zu berichten, soweit ich dazu im Stande bin.
Der Vater ist im Gegensatz zu seinem sanften Bruder Gustav ein flotter Knabe gewesen, dessen
Erziehung bei den vorgerückten Jahren und der außerhäuslichen Tätigkeit seines Vaters,
hauptsächlich in den Händen seiner Mutter ruhte. Er wurde deshalb, sobald es möglich war, dem
Alumnat im Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg anvertraut, das schon sein Vater besucht
hatte, und das einen Ruf als Erziehungsinstitut in humanistischem Sinn genoß. Hier absolvierte
der Vater die Reifeprüfung zum Besuche einer Universität. Im Einverständnis und nach dem
naheliegenden Vorbild eines Vaters und auch auf den besonderen Wunsch seiner Mutter wandte
er sich dem Rechtsstudium zu. Dazu besuchte er in den ersten Semestern die Universität
Heidelberg, die einen besonderen Ruf genoß und von den Söhnen wohlhabender Familien zum
Studium bevorzugt wurde. Im Sommer 1841 bezog er die Universität Berlin, um sein Studium zu
beenden und zur Prüfung zu arbeiten. Während er in Heidelberg dem Ersten Studentenkorps, der
Saxo Borussia, angehört hatte, und, wie sein Schlägerkorb und seine Corpsbänder anzeigen, ein
flotter Schläger war, der den Mensurgegner regelmäßig abführte, blieb er in Berlin dem
Corpsleben fern und arbeitete so fleißig, daß er sich schon am 4. April 1842 beim Justizminister
Mühler zur Ablegung der Prüfung als Amtskultator melden konnte. Diese Prüfung ist inzwischen
abgeschafft worden. Der Vater legte die Prüfung vor dem Kammergericht am 11. Mai 1842 ab
und wurde auf seinen Antrag dem Oberlandesgericht zu Frankfurt/Oder überwiesen, wo ja sein
Vater lebte. Hier arbeitete der Vater auf dem damals vereinten Land- und Stadtgericht. Im Herbst
1844 meldete er sich zur Ablegung der Prüfung zum Referendar, worauf er nach ihrem Bestehen,
und nachdem er die Erklärung, keine Schulden zu haben, abgegeben hatte, zum Referendar mit
Dienstalter vom 7. November 1844 ernannt wurde. Im September 1846 meldete sich der Vater zur
Ablegung der 3. Juristischen Prüfung bei der Immediat-Justiz-Examinations-Commission in Berlin
an, und wurde nach bestandener Prüfung zum Oberlandesgerichts-Assessor ernannt mit einer
Bestallung vom 12. März 1847 und einem Dienstalter vom 2. März desselben Jahres durch den
damaligen Justizminister Uhden. Hiernach wurden ihm die Geschäfte eines Regierungsrats
übertragen. Der Vater erbat 1850 die Entlassung aus dem Justizdienst und wurde mit Dekret vom
31. Oktober 1850 zum Regierungsassessor ernannt. Damit waren seine und seiner Eltern
Wünsche erfüllt worden. Er bezog nun eine jährliche Remmuneration von 600 Talern. Nach
Ablegung der Assessorprüfung hielten die Großeltern im Interesse der Gesundheit des Vaters
nach den Jahren angestrengter Arbeit es für geboten, auch der damaligen Sitte in den gebildeten
Familien entsprechend, ihn zu einer längeren Italienfahrt zu veranlassen. Der nötige Urlaub wurde
dem Vater ohne Anstand erteilt, und im März 1847 begab er sich mit dem Sohn der befreundeten
Familie Ratke auf die "Tour nach Italien" über Berlin, Wien, Triest nach Venedig. Seine
Erlebnisse, Eindrücke und Beobachtungen hat er in einem Tagebuch niedergelegt, das sich mit
einem Päckchen Rechnungen und Notizen, sowie Briefen, die mit der Familie gewechselt waren,
in seinem Nachlaß vorfand und hier beigefügt ist. Von Venedig aus ging die Tour über Rom,
Florenz, Capri bis nach Sizilien, wo Syrakus, Palermo besucht wurden. Aus allen besuchten Orten
brachte der Vater Bilder mit, die er dann in einem Album mit gepreßter Lederfassung vereinigte
und das noch erhalten ist.
Hier möchte ich einschalten, daß im Nachlaß des Vaters eine Anzahl "Stammbücher" sich fanden,
darunter das seines Vaters aus dem Jahre 1788 mit Eintragungen von Mitschülern,
Studienfreunden, Bekannten und Verwandten. Aus der Erbschaft des Vaters stammt unter
anderem ein Kinderportrait, das seine Eltern in Frankfurt durch einen Berliner Portraitmaler
anfertigen ließen. Hierzu erzählte uns Kindern der Vater, daß sein Vater dem Künstler
vorgeschlagen hatte, den lebhaften ältesten Sohn Adolf, also meinen Vater, mit der Fahne
darzustellen, den jüngeren Gustav, der weicheren Gemüts und deshalb der Liebling der Mutter
war, aber mit der Taube. Der Künstler aber verwechselte beides. Er stellte den jüngeren,
folgsameren Sohn mit der Fahne dar. Diese Fahne gab einen tadellosen Hintergrund für die
Locken des Onkel Gustav ab, und der Künstler, dessen Name leider nicht bekannt ist, hatte
jedenfalls mit der Verwechslung das Richtige getroffen. Der folgsame Onkel Gustav wurde später
Offizier, während mein Vater ein stiller, überlegender, abwägender Jurist wurde.
*[Bemerkung: Ich, Anneliese Wittke, geb. Schartow, Enkelin des Adolf Benedikt Schartow, besitze
eine Miniatur dieses Kinderbildnisses. Ich schenkte sie meiner Tochter Dorlies Falkenhagen, geb.
Wittke. - 23.1.1962]
Nach dieser Abschweifung kehre ich wieder zum weiteren Lebenslauf des Vaters zurück. Auf
Allerhöchstes Dekret des Königs Friedrich Wilhelm IV vom 10. Januar 1854, gegengezeichnet
vom Minister des Innern von Westphalen und vom Finanzminister von Bodelschwingh wurde auf
Vorschlag des Frankfurter Regierungspräsidenten von Selchow der Vater zum Regierungsrat
befördert und zum 1. April desselben Jahres vom Minister von Patow als Hilfsarbeiter ins
Finanzministerium nach Berlin berufen. Auf desselben Ministers Vorschlag wurde der Vater zum
Geheimen Oberfinanzrat ernannt und erhielt beim Übergange der Abteilung für direkte Steuern,
Domänen und Forsten vom Finanzministerium in das neu errichtete Ministerium für Landwirtschaft
den Titel Geheimer Oberregierungsrat, ausgefertigt durch Finanzminister Hobrecht und Minister
Friedenthal. Am 17. Juni 1880 wurde der Vater zum Wirklichen Geheimen Oberregierungsrat mit
dem Range der Räte erster Klasse und Direktor der Abteilung Domänen im
Landwirtschaftsministerium ernannt. Dieses Amt hatte er bis zum 1. April 1883 inne. Er stand im
66. Lebensjahr und hatte als letzte Ordensauszeichnung 1881 den Stern zum Roten Adlerorden
II. Klasse mit der Schleife verliehen erhalten. Das ist in aller Kürze die Darstellung der dienstlichen
Laufbahn des Vaters. Er war ein arbeitsamer, nie ermüdender Beamter, unterstützt von einer
seltenen körperlichen Rüstigkeit und geistigen Frische, verbunden mit einem staunenswerten
Gedächtnis, besonderen Kenntnissen der Geschichte, die ihn immer interessierte, und die er
durch Lesen zahlreicher Bücher ergänzte. Er war ein guter Menschenkenner, ein scharfer
Beurteiler und voll Dankbarkeit und Anerkennung geleisteter Dienste. Faule Menschen und flaue
Politiker waren ihm ein Greul. Er war königstreu und konservativ bis in die Knochen. Nach oben
war er ein aufrechter Mann, kein Kriecher, wie einzelne seiner Kollegen. Nach unten war er für
geleistete Arbeit anerkennend und dankbar und förderte Fleiß und Arbeitsamkeit. Soviel über den
Vater als Beamter und Mann. Nun zu seiner Familie.
Der Vater verlobte sich am 16. September mit der verwitweten Frau Kanzleirat Wilhelmine
Berend, geb. Köhne, geboren am 6.1.1823 in Berlin. Die Hochzeit fand am 16. Dezember 1849 in
Berlin statt. Das war auch der Hochzeitstag seiner Eltern. Aus der ersten Ehe meiner Mutter
stammte unsere Halb-, aber Lieblingsschwester Johanna. Die Urgroßmutter dieser Halbschwester
Johanna Behrend war die am 11. April 1759 geborene Johanna Schartow, Tochter des am 24.
Juli 1726 geborenen Christian Schartow in Magdeburg. Sie war mit einem Herrn Kunckel in Berlin
verheiratet. Aus dieser Familie Kunckel leben Nachkommen in Berlin und Castrop-Rauxel
(Bergrat). Die Kinder aus der Ehe meines Vaters mit Wilhelmine Köhne stehen auf Blatt 8 der
Stammtafeln verzeichnet, es waren 9 Geschwister. Ich, der unter 9. dort aufgeführte Adolf
Friedrich Benedict setze nun hier als der derzeit Älteste die Familienaufzeichnungen fort. Ich bin
in Frankfurt/Oder geboren. Meine Erinnerungen an die ersten Jahre sind gering, sie liegen auch
weit zurück. Die Eltern wohnten in der sogenannten Seidenfabrik, einem alten Gebäude mit
großen Räumen, mit Bogenfenstern und Bogentüren. Wir Kinder bewohnten ein Zimmer nach der
Oder hinaus, aus dem wir die Oderbrücke beobachten konnten. Wir freuten uns, wenn unsere
Schwester Johanna in der Abenddämmerung nach Hause kam. Wir konnten sie an einem
Laternchen mit farbigen Gläsern von Weitem erkennen, das sie in der Hand trug.
Straßenbeleuchtung war damals mangelhaft, und die Brücke war dunkel. Johanna mußte in die
jenseits des Stromes in der Altstadt gelegene Schule wandern. Die Großeltern wohnten in einem
großen Hause mit einem Rasenplatz davor, "um die halbe Stadt", wie die Straße hieß. Vor dem
Hause stand ein Doppelposten, was uns Kindern sehr imponierte. In dem Hause wohnte nämlich
auch der Gernisonälteste, in dessen Wohnung sich die Fahnen des Grenadierregiments
befanden. Die Mutter nahm mich häufig mit zur Post, wo wir den Vater erwarteten, der von
seinigen häufigen Dienstreisen mit der Fahrpost zurückkam. Auch auf die Ausflüge nach der
Buschmühle besinne ich mich, wo wir Kinder herumtollten. Im Sommer 1854 übersiedelten wir
nach Berlin, wohin der Vater versetzt war. Auf den Abschied besinne ich mich noch, der
Großvater mit seinen großen Figur und einem Krückstock, im dunklen Anzug, die Großmutter
streng mit herbem Gesicht und viel guten Ermahnungen. Bei den 5 Kindern war das auch wohl
nötig. In Berlin wohnten wir zuerst in einem niedrigen Haus in der Bendlerstraße nahe dem
Tiergarten. Zum Winter bezogen wir eine größere Wohnung in der Matthäikirchstraße, nahe dem
Kanal. Hier wurde mein Bruder Wilhelm geboren, der erste unserer Geschwister in Berlin
geborene. Die Wohnung wurde wohl bald zu klein, denn wir verzogen 1859 in eine große
Wohnung, Eichhornstraße 4, auch wieder im 2. Stock. Wie es damals Sitte war, machten die
Eltern bei den Mitbewohnern Besuche. Daraus wurde manchmal ein gewisser Verkehr. Hier
wohnte im Erdgeschoß ein älteres Fräulein von Rahden, die nur im Winter in Berlin lebte. Mit
dieser Dame verkehrten die Eltern an sogenannten W[unleserlich]-Abenden. Sie war eine große,
stattliche Persönlichkeit, die häufig von ihrem Neffen, einem Kavallerieoffizier mit klirrendem
Säbel und Sporen, der von uns Kindern angestaunt wurde. Dieser von Rhaden machte später viel
von sich reden, weil er die berühmte Sängerin Pauline Luna heiratete. Die Wohnung wurde vom
Hausbesitzer gekündigt mit der Begründung, daß die Mieter sich über die Unruhe durch die
Kinder beklagt hätten; und die Eltern waren nun gezwungen, eine Erdgeschoßwohnung zu
suchen. Die fand sich Hafenplatz 4, Ecke Dessauer Straße im sogenannten Maurischen Hause,
das einem Herrn von Diebitsch gehörte. Die Wohnung war geräumig und hatte den Vorzug eines
Badezimmers, leider streikte die Badeeinrichtung, so daß die Benutzung aussetzen mußte, wir
Kinder konnten nur in der übergroßen Wanne , die niemals leer lief, kleine Schiffe schwimmen
lassen. Zu den Mitbewohnern gehörten die Familien von Funcke, die nur im Winter in Berlin
lebten, Landforstmeister Ulrici, ein Jugendfreund des Vaters aus Frankfurt, und eine jüdische
Familie Leo, die aus den Eltern und einer Tochter im Alter meiner Schwester Marianne stand. Es
entwickelte sich bald ein freundschaftlicher Verkehr, der auch später viele Jahre anhielt. Das war
um 1862. Seit 1860 fuhren die Eltern mit Kindern und Dienstboten in das Solbad Kösen, die
sogenannte Berliner Kinderstube, wo die Ferien zugebracht wurden. Ich war seit Ostern Nouauer
[?]. deshalb erhielt ich am ersten Ferientag eine Flasche Atizerintinte zur Bewältigung der
Ferienaufgaben. Ich ließ die Flasche versehentlich auf die weiß gescheuerten Stubendielen fallen
und erntete nun die ersten Ferienprügel. Am Ferienschluß nach 4 Wochen Solebädern fuhr der
Vater mit uns zwei Buben nach Berlin zurück. Schwester Johanna mußte zur Wirtschaftsführung
mit. Die Mutter und die anderen Schwestern blieben noch 4 Wochen in Kösen. Diese
Sommerreisen zum Solbad Kösen blieben in den Jahren bis 1866 bei. Das waren für Alt und Jung
herrliche Erholungswochen. Der Vater mietete für unseren Aufenthalt regelmäßig ein Fuhrwerk,
so daß wir alle Tage Ausflüge ohne Beschwerden machen konnten. Er besuchte mit uns älteren
Kindern auch regelmäßig Weimar und die Wartburg.
Im Jahre 1861 erlebten wir den Einzug König Wilhelms nach der Königsberger Krönung in Berlin.
Dazu hatte der Vater in der Einzugsstraße ein Zimmer mit zwei Fenstern gemietet. Im Sommer
1866 während des Krieges gegen das katholische Österreich brach in Berlin die Cholera aus. Die
Fenster unserer Parterrewohnung blieben tagsüber geschlossen, weil lange Züge Wagen aller Art
die Leichen aus der Stadt nach den Friedhöfen jenseits des Kanals fuhren. Die Leichen waren nur
wenig bekleidet, oft waren sie nur mit Lumpen oder einem alten Teppich bedeckt. Vor den Wagen
schritten Leute mit Klingeln zum Verwarnen des Publikums. Wir fuhren nicht nach Kösen, blieben
bis zum Friedensschluß in Berlin und sahen auch den Einzug der siegreichen Truppen. Weil der
Wirt gekündigt hatte, kaufte der Vater, kurz entschlossen, das Haus Schellingstr. 4, wo wir am 1.
Oktober 1866 eine Wohnung bezogen und von nun ab von Hauswirten unabhängig waren. In
derselben Etage mit uns wohnte Großmama Köhne, die freilich eigene Wirtschaftsführung mit
Mädchen hatte, aber doch unser täglicher Gast war. Im Sommer lebte sie auf dem Pachtgut ihres
Sohnes Wilhelm in Hohenschönhausen. Die nächsten Sommerferien verlebten wir im
Harzstädtchen Grund, wo auch des Vaters Bruder Gustav mit seiner Tochter Cäcilie aus
Wiesbaden, ihrem ständigen Wohnsitz, eintrafen. Am 5. März 1870 verheiratete sich unsere
älteste Schwester Johanna - einziges Kind unserer Mutter aus erster Ehe mit Kanzleirat Behrend -
mit dem Oberförster Rudolf Witzmann. Das war die erste Lücke, die das Schicksal in unseren
Familienkreis riß. Der Ausbruch des Krieges gegen Frankreich 1870 verhinderte alle Reisepläne.
Der Vater hatte seine alljährige Bade- und Trinkkur in Kissingen glücklicherweise schon hinter
sich. Die ersten Siegesnachrichten riefen in Berlin große Freude hervor, die sich ins Riesenhafte
steigerte, als am 2. September die Nachricht von Napoleons Gefangennahme eintraf. Der Jubel
kannte keine Grenzen, wurde aber schnell eingedämmt, als der Krieg gegen die Pariser
Regierung fortgesetzt wurde und erst durch den Friedensschluß in Frankfurt am Main am 10. Mai
1871 seinen Abschluß fand. Des Vaters Bruder Gustav war während des Krieges Kommandant
der Hauptetappe in Nancy, als er im September 1870 das Unglück hatte, seine Frau in
Wiesbaden durch ein Lungenleiden zu verlieren. Unser Vater mußte die Beisetzung besorgen,
weil sein Bruder in Nancy unabkömmlich war.
Hier möchte ich eine Episode einflechten, die die Überlegung und Tatkraft des Onkels Gustav
kennzeichnet: Die Franzosen hatten heimlich den Bahndamm bei Nancy gesprengt, um die Zufuhr
aus Deutschland nach Paris zu zerstören. Da ließ der Onkel täglich durch eine Militärkapelle der
Besatzung auf dem Marktplatz von Nancy ein Konzert veranstalten, das die Bewohner von Stadt
und Land herbeilockte, um den preußischen Tönen zu lauschen. Als am Sonntag Mittag wieder
der Markt wieder von französischen Lauschern wimmelte, ließ er die Zugangsstraße durch
Patrouillen absperren und nahm die gesamte französische Männlichkeit gefangen. Sie mußten
nun, wie sie gingen und standen, an dem Bahndamm Tag und Nacht bis zu seiner
Wiederherstellung arbeiten; und auf der Maschine, die den ersten Zug über die hergestellte Lücke
zog, mußte der maire mit einer Anzahl Stadträte Platz nehmen. Das Verfahren hatte sich bewehrt,
die Bahnstrecken wurden vor weiteren Zerstörungen durch die Franzosen bewahrt. -
Bald nach dem Friedensschluß hatte der Vater die Freude, daß sich seine älteste Tochter
Auguste verlobte mit dem damaligen Regierungsassessor Ernst Heinsius. Die Hochzeit fand am
24. September 1872 am Geburtstage der Braut in Berlin in einem Hotel unter den Linden statt. -
Am 16. September 1874 feierten die Eltern das Fest der Silbernen Hochzeit im engsten
Familienkreise. Gäste waren nicht geladen. Der Vater wünschte das nicht, weil eine Grenze der
Einzuladenden nicht gezogen werden konnte. Allmählich verkleinerte sich nun die Familie. Ich
machte im Herbst 1875 das Abiturium und verließ das Elternhaus. Die zweite Tochter Sophie
verheiratete sich am 15. Oktober 1877 mit dem Regierungsassessor Carl Loewe, der Landrat in
Heinsberg Bezirk Aachen wurde. Am 24. Januar 1878 starb die Großmama Koehne. In
demselben Jahr ging mein Bruder Wilhelm zur Universität Tübingen zum Studium der
Jurisprudenz nach dem Wunsch des Vaters. Da die Eltern jetzt nur noch drei Töchter im Hause
hatten, bezogen sie eine kleinere Wohnung in der Derfflingerstraße , die sie 1880 mit der
Dienstwohnung am Tempelhofer Ufer tauschen mußten. Nach der 1889 erfolgten Pensionierung
des Vaters bezogen die Eltern eine Wohnung in der Köthenerstraße, sie blieben aber immer in
Berlin W.W.
Im Jahre 1887 heiratete mein Bruder Wilhelm im Februar, ich im August desselben Jahres.
Endlich heiratete noch meine Schwester Marianne 1889 einen Kaufmann Springorum. So blieben
den Eltern in ihren letzten Lebensjahren nur noch die beiden jüngsten Töchter Wilhelmine und
Dorothea im Hause. Deshalb verkaufte der Vater bald sein Haus in der Schellingstraße, um die
Mühe der Verwaltung los zu sein. Er hatte das Haus für 60.000 Taler 1866 gekauft, beim Verkauf
brachte es 120.000 Taler. - Unsere liebe gütige Mutter starb am 27. November 1896 nach
jahrelangem asthmatischen Beschwerden, die sie lange schon an den Rollstuhl gefesselt hatten.
Vor ihr war schon 1889 mein Bruder an einer Rippen- und Brustfellentzündung und ihren bösen
Folgen in Arosa in der Schweiz, wohin er von den Ärzten, allerdings ohne Hoffnung auf
Wiederherstellung geschickt war, gestorben. Er hinterließ seine Witwe und einen Sohn, der im
Kriege 1914/18 im Felde als Offizier gestorben ist. (Walter war sein Name.)
Zur Feier des 80. Geburtstages des Vaters am 30. September 1897 hatte sich mit mir meine
beiden Vettern Hans und Ernst, die Söhne des Vatersbruders Gustav Schartow eingefunden. Der
Vater war immer noch lebhaften Geistes, aber körperlich schwach. Er starb am 13. Dezember
1899 mittags an Altersschwäche im 83. Lebensjahr. Ich begleitete ihn, wie 1896 die Mutter, zur
Erbbegräbnisstelle auf dem alten Friedhof in Frankfurt/Oder. Er war mir ein gütiger Vater.
Dieselbe Liebe und Dankbarkeit hege ich für meine gütige Mutter. Sie stammte aus der alten und
angesehenen Familie Koehne, die ihren Sitz in den Pommerschen Städten Kolberg, Köslin,
Stargard hatte und zum Teil hohe Ämter unter den Preußischen Königen verwalteten, auch als
Bürgermeister dem Staate dienten. Ihr Vater war der Sohn des Hofgerichtskonsistorialrats
Koehne in Köslin, der in Stargard als Sohn des Bürgermeisters Jakob friedrich Koehne und der
Anna Sophie Meyer aus Belgard am 24. März 1735 geboren war und sich mit Charlotte Henriette
Elisabeth Oldenbruch am 11. Juli 1772 in Stargard vermählt hatte. Der Stammbaum der Familie
Koehne reicht weit zurück, es ist mir leider nicht bekannt, in wessen Händen er sich jetzt befindet.
Meiner Mutter Vater war der Geheime Archivrat Carl Bernhard Wilhelm Koehne in Berlin (siehe
Blatt 3 der Familientafel). Er war seit 24.3.1816 verheiratet mit Henriette Sophie Charlotte
Andresse, die eine Tochter der Susanne Schartow und des Johann Heinrich Michael Andresse
war, wie auf dem genannten Blatt 3 ersichtlich ist.
Die Mutter war in erster Ehe mit Albert Behrend verheiratet gewesen, dessen Großmutter
Johanna Kunckel die ältere Schwester der vorher genannten Susanne Andresse war, beides
Töchter des Christian Schartow und der Susanne Rumpf in Magdeburg (Blatt 2 der Stammtafel).
Aus dieser Ehe meiner Mutter lebte meine, also Halbschwester, Johanna.
Mit dem Vater hatte meine Mutter 9 Kinder (Blatt 8). Davon starben im Jugendalter Adolf und
Christian, mein Bruder Wilhelm im 32. Lebensjahr, die übrigen wurden über 70 Jahre alt.
Die Mutter war die einzige Tochter nach 4 Söhnen, wurde in Berlin erzogen und, wie sie oft
erzählte, reichlich verwöhnt. Der Großvater Koehne besaß in Berlin ein umfangreiches
Grundstück in der Wilhelmstraße, das dem Palais des Prinzen Albrecht benachbart war und wie
dieses an die damalige Stadtmauer, jetzt Königgrätzer Straße, reichte. An der Wihelmstraßenfront
stand ein mehrstöckiges Haus, dessen Wohnungen vermietet waren. An dem geräumigen Hof
stand das Gartenhaus mit der Front zum Garten. Das Bild ist auf einem Aquarell festgehalten.
Wenn die Eltern mit uns Kindern aus Frankfurt zum Besuch der Großeltern kamen, wohnten wir in
dem oberen Stock. Im ersten Stock befand sich ein großer, ovaler Saal mit den Koehne'schen
Familienbildern, in dem gespeist wurde. Uns Kindern imponierten die alten Portraits, vor denen wir
uns fürchteten. Nach seiner Pensionierung verkaufte der Großvater leider das wertvolle
Grundstück und bezog eine Mietswohnung in der Linkstraße. Die Mutter besuchte als Kind die
damals bevorzugte Elisabethschule in der Kochstraße und wurde nebenbei durch eine Französin
im Hause unterrichtet. Die Kenntnis der französischen Sprache galt damals noch als gebildet und
nötig. Mit ihren Eltern besuchte die Mutter vielfach die deutschen Badeorte in der Mark und in
Schlesien, wovon die Bilder in ihrem Reisealbum Zeugnis ablegen. Sie war eine prachtvolle Mutter
und in der Familie von allen hochgeachtet und verehrt. Die Ehe unserer Eltern war eine vorbildlich
glückliche. Wir Kinder verdanken unsern Eltern viel, der Haushalt wurde reich geführt, Mangel
kannten wir nicht. Der Vater hatte immer offene Hand für Wünsche und förderte unsere
Kenntnisse nach jeder Richtung. Jedes Talent wurde unterstützt und erhielt Unterricht durch
geeignete Lehrer, die manchmal recht teuer waren. Die große Familie brachte es mit sich, daß sie
sich allmählich zerstreute. Beim Tode der Eltern waren nur einige der Schwestern noch in Berlin,
nämlich die älteste, verheiratete Heinsius, und die beiden jüngsten, die unvermählt als Portraitund
Porzellanmalerinnen bei den Eltern lebten.
Von den Schwestern sehe ich bei meiner weiteren Niederschrift ab. Nur meines verstorbenen
Bruders Wilhelm Familie will ich erwähnen. Nach dem im Kriege 1914/18 erfolgten Ableben
seines Sohnes Walter an der russischen Front, gab seine Frau Anna geb. Bütow ihren Aufenthalt
in der Uckermark auf und verzog mit ihrem einzigen Kind, Friedrich Wilhelm Schartow, nach
Göteborg in Schweden. Ich habe nichts mehr von ihr gehört.
Für die lieben Eltern hege ich die größte Liebe, Ehrerbietung und Dankbarkeit. Aus meiner
Kindheit will ich kurz berichten. Nach den üblichen Kinderkrankheiten Masern, Windpocken und
Scharlach litt ich öfter an Halsentzündungen, so daß die Eltern ängstlich wurden. Es stellten sich
auch schwere Zahngeschwüre ein, die Fistelbildungen befürchten ließen. Die in Frage
kommenden Zähne mußten unter Anwendung von Narkose entfernt werden. Die auftretenden
Geschwülste verschwanden nur langsam, ich mußte lange der Schule fernbleiben und wurde für
die Eltern ein rechtes Sorgenkind. Dank der Pflege im Elternhaus wurde ich doch ein ganz
gesunder Junge, wenn ich auch zu meinem Ärger nicht die Körpergröße erreichte, die bei den
männlichen Angehörigen unserer Familie traditionell war. Mein jüngerer Bruder war einen Kopf
größer als ich, und meine Vettern Hans und Ernst waren 1,78 und 1,80 groß. Nach dem Abiturium
wandte ich mich der Forstverwaltungslaufbahn zu. Ich besaß ein außerordentlich scharfes Auge
und Gehör, war äußerst zähe und konnte stundenlang ohne Nahrung aushalten, behielt daher
immer eine schlanke Figur. Die Forstlaufbahn war damals langwierig und deshalb teuer. Nach
kurzer Lehrzeit auf dem Buchenrevier Mühlenbeck nahe Stettin, bezog ich die Forstakademie
Eberswalde, machte Herbst 1878 die Referendarprüfung, diente bis Herbst 1879 gemeinsam mit
meinem Bruder beim 2. Garderegiment in Berlin, wo wir beide Reserveoffiziere im Regiment
wurden. Dann legte ich das Feldmesserexamen bei der Potsdamer Regierung ab und die
vorgeschriebene zweijährige Referendarzeit auf Revieren. Ich war in den Bezirken Breslau,
Stettin, Coblenz, Hildesheim, Erfurt, Posen, erledigte dazwischen die nötigen Übungen beim
Regiment und bestand Herbst 1883 das Assessorexamen, verwaltete Bischofswald und
Letzlingen, arbeitete in Katholisch Hannover, Kuhbrück, Reichersdorf, und erhielt am 1. Juli 1887
die Verwaltung von Argenau im damaligen Bezirk Bromberg, wo ich bis zu meiner Pensionierung
am 1. Januar 1920 verblieb. Während des Krieges mußte ich noch die Nachbarreviere Woduk
und Schirpitz verwalten. Unsern Alterssitz verlegten wir nach Naumburg/Saale. - Über meine Ehe
und mein Familienleben hebe ich in einem besonderen Heft berichtet und in den
Kriegstagebüchern vom 31. Juli 1914 ab.
Ehe ich den Schlußpunkt unter diesen Abschnitt unserer Familiengeschichte setze, muß ich noch
einer Überlieferung gedenken, die sich in unserer Familie erhalten hat und zu interessant ist, um
in Vergessenheit zu geraten. Der Familienname meiner Großmutter mütterlicherseits Sophie
Koehne (Seit 3 Tafel) war Andresse. Die Großmutter war am 14. September 1792 in Berlin
geboren. Ihre Eltern waren der am 8. Februar 1756 in Berlin geborene und daselbst am 4.
Oktober 1824 verstorbene Obergerichtsrat Johann Heinrich Michael Andresse und seine Ehefrau
Wilhelmine Charlotte Katharina Susanne Schartow, die am 4. Dezember 1761 in Magdeburg als
3. Kind und 2. Tochter des Christian Schartow, also meines Ururgroßvaters geboren war (Blatt 1,
2 und 3). Der Urahne Christian Schartow war verheiratet mit Susanne Margarete Rumpf, Tochter
eines Weingroßhändlers in Magdeburg. Die vorgenannte Susanne Schartow ist am 31. März 1838
in Berlin verstorben. Ihr Gatte, der oben genannte Johann Heinrich Michael Andresse war am 29.
September 1724 in Weißrußland (Ukraine) geboren und hieß ursprünglich Jendrcejewski, der
slawischen Übersetzung von Andréas, und nannte sich nun in Deutschland mit obrigkeitlicher
Genehmigung Andrésse. Die Familie Jendrcejewski vom Wappen Nalec war dem Polenkönig
Johann III Sobieski zum Königsdienst verpflichtet, wie fast alle polnischen Adelsgeschlechter.
Eines ihrer Mitglieder hat auf Grund dieser Verpflichtung den Krieg gegen die Türken zum
Entsatze Wiens mitgemacht und bei der Plünderung des Türkenlagers nach der Schlacht am
Kahlenberge 1683 im Zelte des Großveziers Kara Mustafa eine junge Türkin erbeutet, die er,
nachdem er sie auf den Namen Konradine hatte taufen lassen, geheiratet hat. Die Mutter dieser
Konradine soll eine Tochter Mohammed IV gewesen sein. Ein im Jahre 1724 in Weißrußland
geborener Johann Michael Jendrcejewski, der Vater des Michael Andresse, mußte als letzter
Lehngutsbesitzer aus Rußland flüchten und wandte sich nach Deutschland, wo er am 2. Mai 1754
eine Tochter des Pastors Johann Peter Womrath aus Omellendorf bei Dessau heiratete. Diese
war am 20. März 1724 geboren und ist am 10.4.1802 in Berlin verstorben. Was an dieser
Familienüberlieferung Wahres ist, läßt sich nicht mehr feststellen. Ich habe die Angaben den sehr
ausführlichen Familienakten der Familie Koehne entnommen. Ganz von der Hand sind sie nicht
zu weisen; auffallend war die Gesichtsform bei meiner Großmutter Koehne; besonders ihre Nase
deutete auf die polnische Abstammung. Der polnische Typ hatte sich auch auf ihre Söhne vererbt,
besonders hervorstechend bei ihrem jüngsten Sohn Adalbert; dessen Tochter Helene und auch
meine Schwester Sophie zeigten die schmale, krumme Polennase noch sehr deutlich!




Adolf Benedikt Schartow - 03.10.18.1853 - 28.02.1933 (Ur-Großvater)
Künstlerin: Schartow, Wilhelmine

(Königl.preuß.Forstmeister in Argenau, Krs.Inowratzlaw
Verheiratet mit: siehe Foto "4 Generationen" - Ur-Großmutter)
*Adolf Benedikt Schartow - 30.09.1817 - 13.12.1899 (Ur-Ur-Großvater)
 Bild 1
Bild 1
(Berufe: Regierungsrat
1817 Geheimer Regierungsrat Ober-und Ministerialdirektor im Landwirtschaftsministerium Berlin
Kommentar: Regierungsrat und Ministerialdirektor im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
 Bild 2
Bild 2
Künstlerin: Schartow, Wilhelmine - Tochter des Dargestellten: "Alter Mann im Lehnstuhl". Öl/Lwd,re.u.sign/ dat: 1899 m. teils nachgezogenem Vornamen, verso Lebensdaten d. Dargestellten Adolf Friedrich Schartow, Ministerial Director 1817 - 1899. Porträt d.greisen Mannes, der lesend im Korbstuhl am geöffneten Fenster mit Petunien sitzt und dem sein Hund Gesellschaft leistet.
Original-Brille des Adolf Benedikt Schartow (Ur-Großvater)

4 Generationen

Links: Caroline Friederike Juliane Salémon geb. Steltzer - 06.11.1835 - 16.06.1899 (Ur-Ur-Großmutter) -
Mitte: Julie Amalie Elisabeth Schartow geb. Salèmon - 21.08.1867 - 10.10.1935 (Ur-Großmutter) -
Rechts: Julie Eleonore Steltzer geb. Jahn - 25.03.1811 - 09.07.1899 (Ur-Ur-Ur-Großmutter) -
Kind: Anneliese Wilhelmine Caroline Wittke geb. Schartow - 01.11.1891 - 07.10.1963 (Großmutter)

Anneliese Wilhelmine Caroline Wittke geb. Schartow - 01.11.1891 - 07.10.1963
General Walter Ernst Wittke - 26.09.1887 - 20.07.1955 - (Großeltern 1917, Königsberg)

Dorothee Elisabeth Antonie Anneliese Falkenhagen - geb. Wittke - 11.12.1920 - (Lebt noch)
General Walter Ernst Wittke - 26.09.1887 - 20.07.1955 - (Mutter + Großvater, 1922)

Anneliese Wilhelmine Caroline Wittke geb. Schartow - 01.11.1891 - 07.10.1963
General Walter Ernst Wittke - 26.09.1887 - 20.07.1955 - (Großeltern 1955, Ruhpolding)

General Walter Wittke - 26.09.1887 - 20.07.1955 - (Großvater)
Es folgen nun 3 Bilder die General Walter Wittke gemalt



Folgende 3 Bilder wurden von
Wilhelmine Schartow - 07.05.1859 - 23.10.1927 der Ur-Großtante meines Mannes gemalt
Friedrich Carl Steltzer - 30.12.1776 - 08.10.1848 - (Ur-Ur-Ur-Großvater)

(Königlich-Preußischer Oberregierungsrat zu Magdeburg)
Julie Eleonore Steltzer geb. Jahn - 25.03.1811 - 09.07.1899 - (Ur-Ur-Ur-Großmutter)

(siehe auch Foto "4 Generationen" - Ur-Ur-Ur-Großmutter)
Wilhelm Benedikt Schartow - 13.02.1898 - 22.06.1915 (Großonkel)

Familienwappen

Schartow

Steltzer